Das Problem des Bösen

Die Schrecken dieser Welt sind gewaltig, ja überwältigend. Zahllos sind die Kranken, Verlassenen, Ausgestoßenen, Gefolterten, Vergewaltigten und Ermordeten dieser Erde. Der Horror verschwindet leicht hinter der Abstraktheit von Begriffen, die ja immer nur das Allgemeine einfangen können. Aber spätestens, wo uns das Schicksal eines unschuldig leidenden Individuums begegnet – etwa der konkrete Fall eines gequälten, missbrauchten, eines ermordeten Kindes –, da stellt sich für jeden Gläubigen wie Gottsuchenden unweigerlich die Frage: Wie kann Gott das zulassen?
Das sogenannte Problem des Bösen ist – zumindest in emotionaler Hinsicht – die wohl drängendste Herausforderung für einen Glauben, der sich wie das Christentum auf einen allmächtigen und vollkommen guten Gott bezieht. Die Rede vom „Bösen“ in diesem Zusammenhang umfasst zum einen das moralische Böse – also menschliche Verbrechen –, zum anderen aber auch natürliche Übel wie Krankheiten oder Naturkatastrophen.
Das Problem gestaltet sich nun wie folgt: Wenn Gott vollkommen gut ist, dann wird er das Böse in jeglicher Form verhindern wollen. Wenn er zudem allmächtig ist, dann kann er seinen Willen auch umsetzen. Warum also rottet Gott nicht alle Krankheiten aus und behebt alle Ungleichgewichte in der Natur, errettet umgehend alle Leidenden aus ihrer Not und legt allen moralischen Monstern in Menschengestalt ein für alle Mal das Handwerk? Dass er das offenbar nicht tut, legt den Schluss nahe, dass Gott entweder nicht vollkommen gut oder nicht allmächtig oder vielleicht sogar keines von beidem ist.
Auch Gott kann keine runden Vierecke erzeugen
Dieses Argument ist nicht so schlüssig, wie es zunächst scheinen mag. Es beruht nämlich auf Annahmen über das Wesen der göttlichen Allmacht und Güte, die sich bei genauerem Nachdenken als unhaltbar erweisen. Betrachten wir zunächst die Allmacht. Dass Gott allmächtig ist, heißt nicht, dass er schlechthin alles tun kann. Logisch Widersprüchliches etwa hebt sich selbst auf und kann daher nicht einmal von Gott bewirkt werden: Auch Gott kann keine runden Vierecke erzeugen, schlicht weil es aus logischen Gründen keine runden Vierecke geben kann.
Die Einsicht in die auf diese Weise „beschränkte“ Allmacht Gottes hat nun auch auf das Problem des Bösen entscheidende Auswirkungen: Wenn es bestimmte Werte und Güter gibt, die aus logischen Gründen nur in Verbindung mit moralischen oder natürlichen Übeln existieren können, dann kann auch ein allmächtiger Gott diesen Zusammenhang nicht aufheben. Wenn Gott also eine Welt mit den entsprechenden Gütern und Werten erschaffen möchte, muss er auch die entsprechenden Übel zulassen.
Das ist nun aber nicht nur eine hypothetische Überlegung. Vielmehr ist unser Leben voller Güter, deren notwendiger Preis in schlimmen Übeln besteht. Als erstes kommt einem in diesem Kontext die menschliche Freiheit in den Sinn. Gott wollte den Menschen offenbar nicht als einen hörigen Automaten erschaffen, sondern als ein Wesen, das aus freien Stücken in eine Liebesbeziehung mit ihm treten kann. Der Preis der Freiheit aber ist die Möglichkeit, sie zu missbrauchen; dieser Missbrauch ist zugleich die Quelle des moralisch Bösen.
Zu hoch der Preis? Eine gigantische Anmaßung
Nun gibt es Philosophen, die behaupten, Gott hätte auch eine Welt erschaffen können, in der freie Menschen zwar die Möglichkeit haben, Böses zu tun, jedoch niemals von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Es ist fraglich, ob dies ein stimmiger Gedanke ist. Aber selbst, wenn man von der Freiheit absieht, gibt es eine ganze Reihe weiterer Güter, die es ohne ihnen korrespondierende Übel nicht geben könnte: Eine Welt ohne böse Taten wäre etwa notwendigerweise eine Welt ohne Verzeihung, Versöhnung und Gnade.
Das ist aber noch lange nicht alles. In einer Welt ohne Leiden und Tod würden nämlich so gut wie alle menschlichen Tugenden obsolet werden: Ohne Risiko für Leib und Leben gäbe es keinen Mut, ohne Schmerz kein Mitleid, ohne die Verführung zu Ausschweifung und Maßlosigkeit keine Mäßigung. Die Tugenden aber sind die elementaren Bausteine unseres Charakters, unserer Seele. Wenn wir als Personen in diesem Leben innerlich wachsen wollen, wird das nicht gehen, ohne mit moralischen und natürlichen Übeln aller Art zu ringen. Das Böse ist daher logisch an die Möglichkeit der „Herzensbildung“ des Menschen gebunden.
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Nun mag sich mancher auf den Standpunkt stellen, der Preis der Freiheit und Tugend sei schlicht zu hoch und es wäre besser gewesen, Gott hätte die Welt ohne diese Güter erschaffen. Doch nach welchem Maßstab wollen endliche Wesen, wie wir es sind, das eigentlich beurteilen? In Wahrheit handelt es sich bei einem solchen Urteil um die gigantische Anmaßung, es besser zu wissen als der allwissende Schöpfer.
Ohne Gott verschärft sich das Problem des Bösen sogar noch
So sehr jemand auch mit Gottes Güte und Allmacht angesichts der Schrecken dieser Welt hadern mag, er muss letztlich einsehen: Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Existenz eines allmächtigen und vollkommen guten Schöpfers einerseits und einer mit moralischen und natürlichen Übeln durchzogenen Welt andererseits.
Das gilt bereits, wenn man nur dieses Leben in Betracht zieht. Weitet man den Blick hin auf ein Leben nach dem Tod, wie es im Christentum verheißen ist, verliert das Problem des Bösen sogar noch weiter an Gewicht. Denn die Perspektive auf das Jenseits erlaubt uns zu denken, dass kein Verbrechen ungesühnt, kein unschuldiges Leid entschädigungslos und keine gute Tat unbelohnt bleibt.
Ganz anders dagegen verhält es sich, wenn der Atheist Recht haben sollte. Denn statt zu verschwinden, verschärft sich das Problem des Bösen sogar noch ohne Gott. Der gerechte Zorn über die Ungerechtigkeiten dieser Welt ehrt den Atheisten. Sein Weltbild aber erlaubt es nicht zu begreifen, woraus sich eine solche moralische Empörung speist. Woher kommt in einem kalten, gottlosen Universum das Verlangen nach vollkommener Gerechtigkeit? Warum sollte auf evolutionärem Weg ein moralisches Bedürfnis nach absoluter Gerechtigkeit entstehen, das in dieser grausamen und ungerechten Welt offenbar gar nicht befriedigt werden kann?
Immanuel Kant hat ausgehend von dieser tief im Menschen verwurzelten Sehnsucht, dass am Ende jeder bekommt, was er verdient, sogar eine Art Gottesbeweis konstruiert: Nur der Allmächtige kann im nächsten Leben die moralischen Mängel unserer irdischen Existenz beheben und unser Glück mit unserer Glückswürdigkeit in Einklang bringen. Ohne Gott als Garant der Gerechtigkeit bleibt in unserem moralischen Denken eine zentrale Leerstelle.
Auf emotionaler Ebene wird das Problem des Bösen wohl nie ganz seinen Stachel verlieren. Eine gründliche Reflexion aber zeigt, dass die Existenz des Bösen uns mitnichten zwingt, die Güte und Allmacht Gottes in Abrede zu stellen.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?


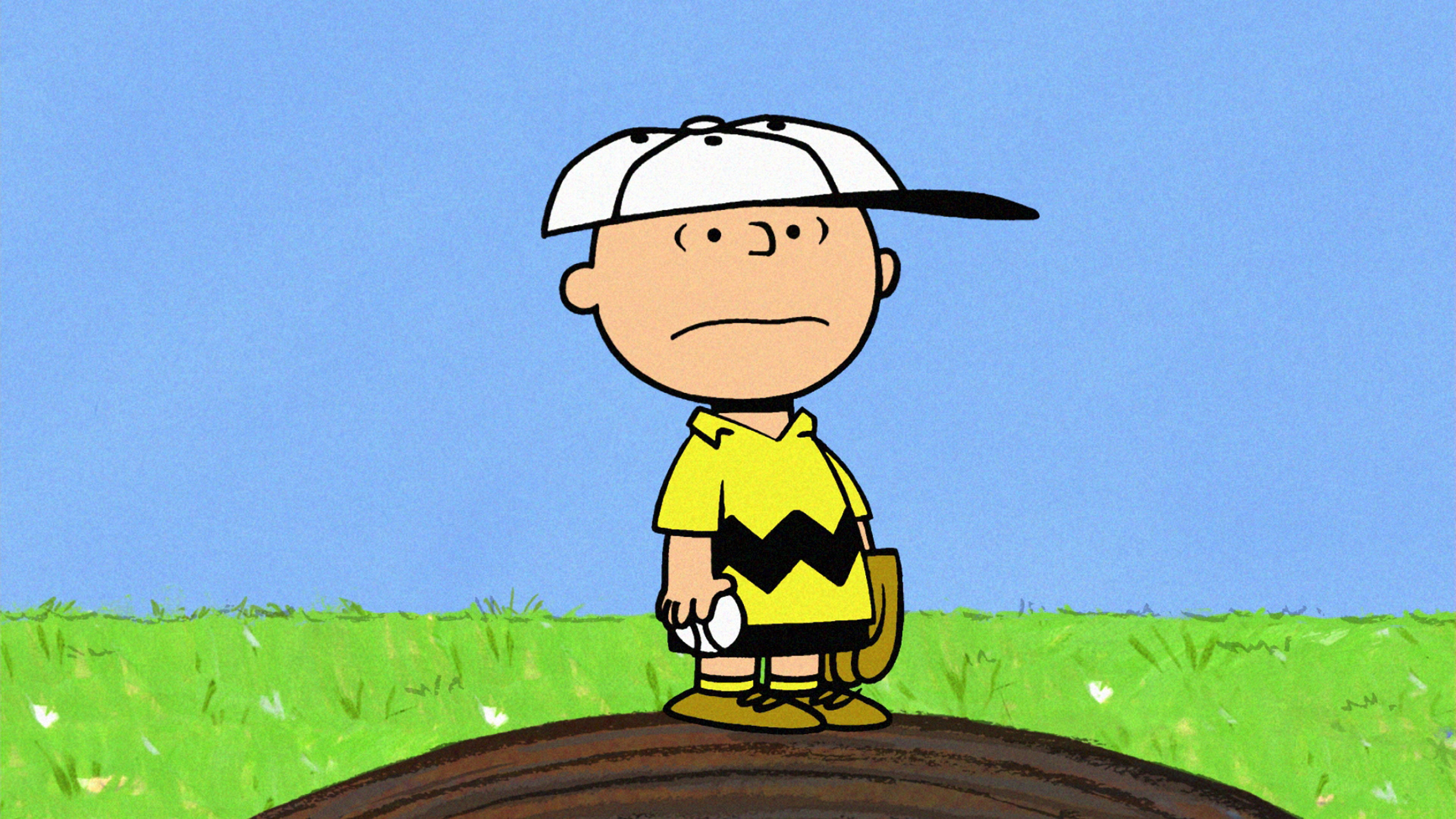


Kommentare
In Religionen wie dem Christentum kennt man das Böse, ist es allgegenwärtig. Es ist Herausforderung und Prüfung für den Menschen. Der Kampf gegen das Böse ist Aufgabe und Berufung.
Wieso hat GOTT die Welt überhaupt erschaffen, wenn es soviel Leid gibt? Gibt es die Gewissheit, dass in der Ewigkeit alle Tränen abgetrocknet werden und wir unsere Lieben wiedersehen? Maximilian Kolbe soll nach seinem Tod im Konzentrationslager seiner Mutter erschienen sein und ihr gesagt haben, es ginge ihm nun gut...
@Rose "Wieso hat GOTT die Welt überhaupt erschaffen, wenn es soviel Leid gibt?"
Diese Frage stellt den Menschen ins Zentrum. Gott hat aber die Schöpfung zu seiner eigenen Ehre geschaffen. Auch die Sündenvergebung durch das Opfer Jesu dient primär der Verherrlichung Gottes (Epheser 1).
Dass es Gottes höchste Verpflichtung sei, dem Menschen maximales Wohlbefinden zu wirken, ist eine fälschliche Annahme, die sich aus unserer sündigen Selbstsucht ergibt.
Die viel wichtigere Frage ist, warum Jesus unschuldig den grausamsten Tod starb, den je jemand gestorben ist. -> aus selbstloser Liebe und um uns das Seelenheil zur freien Verfügung anzubieten für jeden, der es glaubend annimmt.
Nicht schlecht, diese Erörterung. Es wirkt wie eine philosophische Annäherung an das apostolische Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. / Amen.
Wer Gott erklären will, meint meist, ihn schützen zu müssen, weil er selber sonst verloren wäre. Es ist nackter Selbserhaltungstrieb.
Die Anatomie Gottes ist das Lehrfach der Theologie. Schaut man genauer hin, erkennt man Mutmaßungen. Augustinus hatte Fragen im Kreis der Manichäer. „Ha, wenn der Faustus da wäre, der könnte das erklären!“, hieß es. Eines Tages war Faustus da. Er konnte sich galanter äußern, aber das war alles. So ist Theologie.
Für mich gibt es eine beruhigende Lösung: Ich weiß die klugen Worte nicht, aber es exisitiert ein göttliches Licht.
Es war das Nahtoderlebnis eines Mannes. Er sah kein weißes Tor, hörte keine himmlischen Klänge. Er fand sich in der Hölle, ein Ort ohne Gott in Ewigkeit. Die völlige Abwesenheit Gottes war eine furchtbare Qual.
Es ist die tief empfundene Gewissheit eines göttlichen Lichtes, was letztlich Frieden schafft. Ohne menschliche Worte ist das allerdings schwierig.
Wer den ersten Satz des apostolischen Glaubensbekenntnisses in all seinen Dimensionen recht versteht, weiß, dass er auf den vertraut, ohne wen nichts ist (creatio ex nihilo). Ein Vertrauen, das deshalb im Leben und im Sterben trägt. Denn gerade weil ohne ihn nichts ist, ist er in allem was ist und geschieht mächtig. Gott lässt nicht das eine zu und anderes nicht. Das ist viel zu klein von ihm gedacht. Er schafft das Gute ebenso wie das Böse (vgl. Jes 45,7). Die Theodizeefrage ergibt sich lediglich für ein Gottesverständnis, das seiner Größe nicht gerecht wird. Es ergibt sich aus der wirklichkeitswidrigen Verneinung des Verhältnisses von Schöpfer zum Geschöpf, das letztlich die Kreatürlichkeit des Menschen leugnet. Man hat diesbezüglich schon immer von der Wurzelsünde des Hochmuts (superbia) gesprochen.
@Wolfgang R. Sehr richtig. In der religiösen Praxis aber oft „Trick 17 mit Selbstüberlistung“.
Die Menschen wollen Gewissheiten haben. Wenn der Kleriker zu abstrakt bleibt, rennen die Leute zu jemanden, der ihnen das Unerklärliche erklärt. So werden Legenden gepflegt. Das wiederum fordert Widerspruch heraus.
Es begann mit dem Biss der Eva in den Apfel. (Wir sind schuld, Gott hat es nur gut gemeint!)
Es war da mit der Behauptung, Mäuse entstünden aus Dreck. (Keine Evolution, Urzeugungen allerorten.)
Es fasziniert die Vorstellung von Astrophysikern, wir existierten als Information und lebten wie in einem Hologramm.