Müde von der Politik

Glaubte man den Plakaten, den Anzeigen in Zeitungen und den Debatten im Fernsehen, stand die Schweiz am 18. Juni vor einer Zeitenwende. Zur Abstimmung stand das sogenannte Klimaschutzgesetz. Es formuliert das Ziel, bis 2050 ein CO2-neutrales Land zu schaffen. Wie man das im Detail erreicht, ist unklar. Aber die Befürworter stellten klar: Ob die Erdkugel demnächst verglüht oder nicht, wird gewissermaßen im Alpenstaat an der Abstimmungsurne entschieden.
Das Resultat war deutlich. Fast 60 Prozent der Stimmberechtigten entschieden, man solle ein Klimaziel definieren. Dabei verließen sie sich auf Versprechungen, wonach es auf diesem Weg weder neue Verbote noch Mehrkosten für den Einzelnen geben würde. Kaum war das Ja verkündet, erklärten dessen Verfechter dann, dass es natürlich Einschnitte geben müsse, anders lasse sich das Ziel ja nicht erreichen. Aber das nur nebenbei.
Jubel auf der einen, Wehklagen auf der anderen Seite: Das ist vier Mal pro Jahr so, wenn die Schweizerinnen und Schweizer zu nationalen Abstimmungssonntagen gerufen werden. Dieses Mal haben sie angesichts des Resultats allerdings eine gemeinsame Sorge: die Stimmbeteiligung.
Das Desinteresse an der Politik wächst
Diese war schon immer mal höher, mal tiefer, lag aber über viele Jahre hinweg im Schnitt bei rund 45 Prozent. Nicht ganz jeder zweite Bürger hatte also jeweils Lust, sein demokratisches Recht wahrzunehmen. Ab 2020 boomte die aktive Bereitschaft dann plötzlich: Die Stimmbeteiligung schoss zunächst auf fast 50, im Jahr 2021 auf 57 Prozent. Es schien, als hätte die Coronazeit bei vielen Leuten ein neues politisches Bewusstsein geweckt.
Aber in Wahrheit war es nur das letzte Aufbäumen vor dem großen Schlaf. Am Sonntag quälten sich gerade noch 42 Prozent an die Urne oder den Briefkasten. Das ist historisch betrachtet kein Rekordtief. Aber es ist dennoch beunruhigend. Denn frühere Abstimmungen mit noch tieferer Stimmbeteiligung waren meist Vorlagen, deren Titel man dem Kind vorgelesen hätte, wenn es nicht einschlafen kann. Oder solche, bei denen einfach vollzogen wurde, was unumgänglich war und es daher nicht einmal eine Opposition gab.
„Bundesbeschluss über die Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung“ oder „Bundesbeschluss über Maßnahmen zur Stabilisierung des Baumarktes“: Mal ehrlich, da holt man der Familie lieber die Sonntagsbrötchen, als zum Rathaus zu pilgern.
Dass ein Entscheid über den Beitritt zum EWR 1992 noch fast 80 Prozent an die Urne lockte, aber irgendwelche technischen Beschlüsse zum Gähnen anregen: das liegt in der Natur der Sache. Aber am vergangenen Sonntag ging es um sehr viel mehr.
Eine niedrige Stimmbeteiligung ist im Sinn der Regierung
Neben dem nebulös formulierten Klimaziel entschied die Schweiz auch darüber, ob die Corona-Maßnahmen vorsichtshalber noch jahrelang auf Abruf bereitgehalten werden sollten. Dieses Thema hat das Land drei Jahre lang förmlich elektrisiert. Und nun waren es noch vier von zehn Schweizern, die befanden, sie würde sich dazu gern vernehmen lassen.
Ein öffentliches Thema ist das erstaunlicherweise kaum. Ein paar Politologen erwähnten die große Unlust schulterzuckend und am Rande. Die Landesregierung, der Bundesrat, ließ sich nicht dazu vernehmen. Zwar wird den Bürgern dauernd eingeschärft, sie sollen das unvergleichliche Privileg der direkten Demokratie aktiv nützen, doch wenn sie es nicht tun, scheint das der Regierung gar nicht mal so zuwider. Zumal, wenn die Resultate wie am Sonntag allesamt in ihrem Sinn ausfallen. Das tun sie bei tiefer Stimmbeteiligung sehr viel eher, wie sich jetzt wieder gezeigt hat.
Es gibt einen einfachen Erklärungsansatz dafür, dass die Schweizer an einem warmen Sonntag lieber den Picknickkorb füllen, als ihre Rechte wahrzunehmen. Die Erkenntnis hat sich eingeschlichen, dass es auf lange Sicht sowieso nichts bringt, Ja oder Nein zu sagen. Beispielsweise, weil sich der Bundesrat immer öfter auf das Notrecht beruft, wie an dieser Stelle auch schon thematisiert wurde. Oder auch, weil sich in den letzten Jahren die Volksinitiativen gehäuft haben, die trotz klarem Ausgang dann nicht oder nicht so wie von den Urhebern geplant umgesetzt wurden.
Ja zu einer Initiative – und das Parlament geht darüber hinweg
Das Paradebeispiel ist einige Jahre her. 2014 sagte eine Mehrheit Ja zur „Masseneinwanderungsinitiative“ der konservativen SVP, der größten Partei im Land. Das Parlament machte in der Nachberatung etwas völlig anderes aus der Vorlage. Statt die Masseneinwanderung zu stoppen, wurde beschlossen, eine Meldepflicht von offenen Stellen an die Arbeitslosenämter einzuführen. Wer nun nicht kapiert, was das eine mit dem anderen zu tun hat, muss nicht an sich zweifeln. Selbst Gegner der Initiative kratzten sich verlegen am Kopf.
Die SVP legte später diverse Male nach mit Initiativen, die der ursprünglichen Vorlage noch zum Durchbruch verhelfen soll. Aber es ist kaum die Idee der direkten Demokratie, dass man alle paar Jahre 100.000 Unterschriften sammeln muss, nur um das zu bekommen, was man eigentlich bereits erreicht hatte.
Ein Bundesrat, der immer öfter mit Notrecht durchregiert, ein Parlament, das sich nicht für die Meinung der Mehrheit der Stimmbürger interessiert: Das ist der Demokratie nicht förderlich. Früher oder später verlieren die Menschen das Interesse an ihrer Einflussmöglichkeit. Das ist vielleicht das aktuell größte Problem der Schweiz.

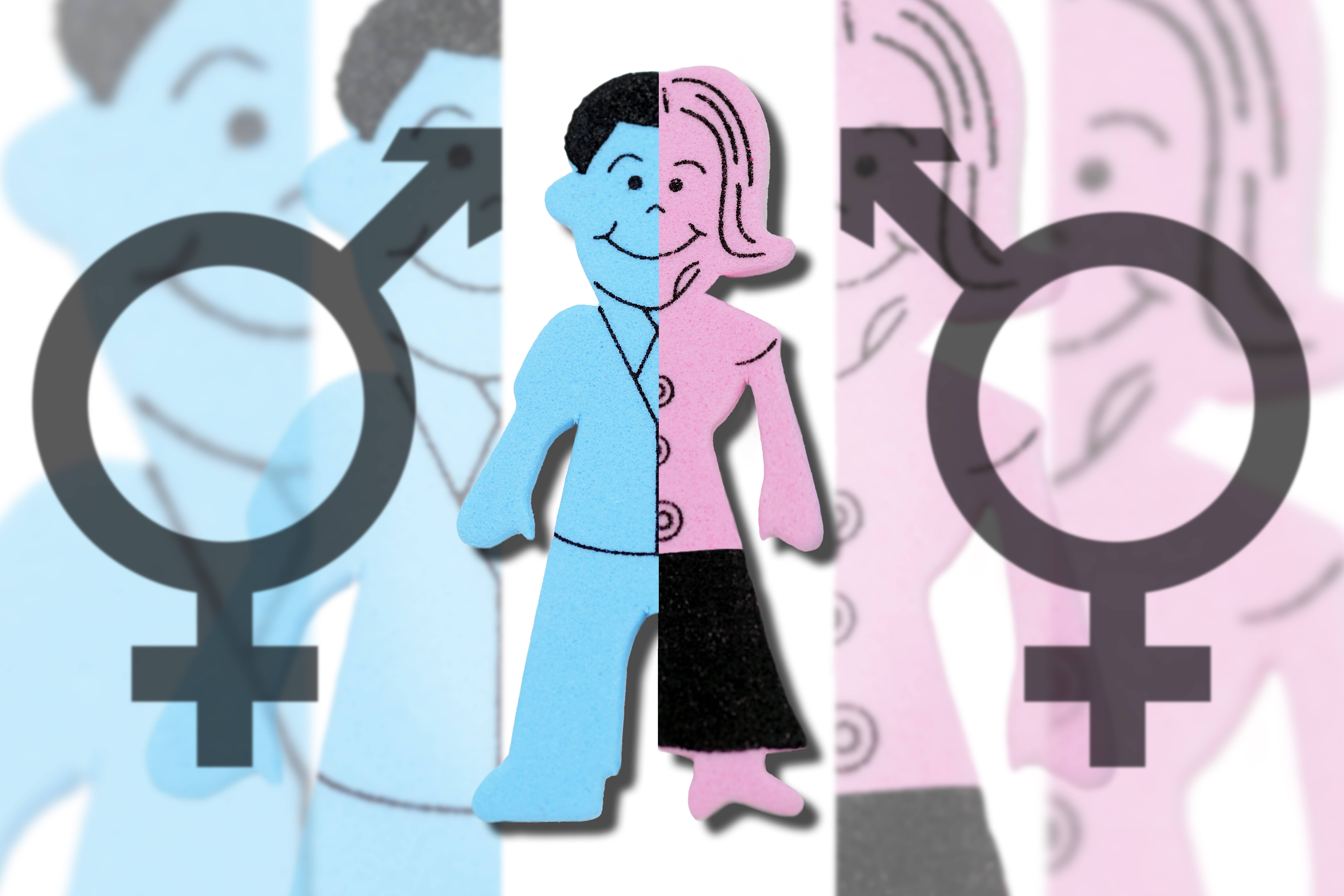



Kommentare