Krieg der Sterne
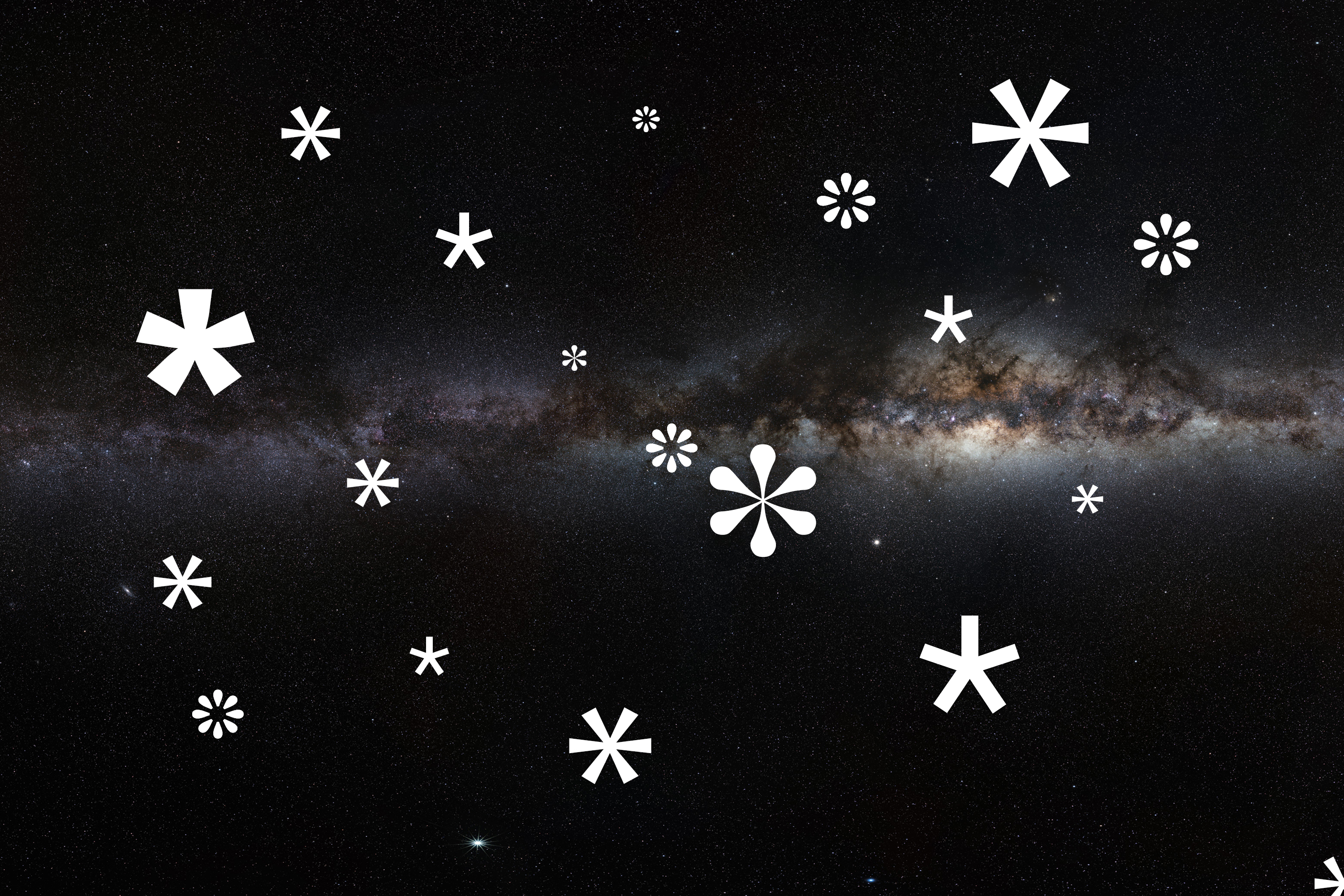
Kürzer und einfacher formuliert waren vermutlich nur wenige Volksinitiativen in der Schweiz. Die Vorlage „Tschüss Genderstern!“, über die in der Stadt Zürich am 24. November abgestimmt wird, besteht aus zwei Sätzen, die unter dem Titel „Verständliche Sprache“ neu den Artikel 65 der Gemeindeordnung bilden sollen:
- Die Behörden verwenden eine klare, verständliche und lesbare Sprache.
- Sie verzichtet in behördlichen Texten auf die Verwendung von Sonderzeichen innerhalb einzelner Wörter.
Nimmt man diverse Umfragen zum Maßstab, müsste sich eine deutliche Mehrheit für diese Initiative aussprechen. Denn fragt man die Schweizer, ist klar: Sie können nichts anfangen mit Gendersternen, Doppelpunkten in Wörtern oder anderen Kunstgriffen. Sie halten sie für unnötig und mühsam. Allerdings ist die linke Stadt Zürich nicht besonders repräsentativ für die ganze Schweiz.
Das Schicksal der nationalen Wirtschaftsmetropole hängt mit Sicherheit nicht von dieser Initiative ab. Sie bietet aber Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen. Denn die Verfechter der sogenannten geschlechtergerechten Sprache werden nicht müde zu behaupten, ihr Anliegen werde breit getragen. Das glauben sie vermutlich wirklich, weil sie sich vornehmlich in ihrer eigenen Blase bewegen, wo es niemandem einfallen würde, Genderstern und Co. kritisch zu hinterfragen. Aber eben: Umfragen sprechen eine andere Sprache.
„Angriff auf Frauen“
Das Rennen ist offen. Schon jetzt steht aber fest, dass die Abstimmung rund um den „Krieg der Sterne“ – oder vielleicht eher „Krieg den Sternen“ – als Beispiel für eine ausgeartete Debatte in die Geschichte eingehen wird. Den Initianten geht es darum, dass behördliche Schriften klar und einfach bleiben und nicht dazu genutzt werden, politische Botschaften zu verbreiten. Ihre Gegner aber wittern etwas ganz anderes dahinter: Einen „Angriff auf Frauen und nonbinäre Personen“.
Diese Bezeichnung stammt aus dem lokalen Onlineportal tsüri.ch. Dort wird suggeriert, hinter „Tschüss Genderstern!“ stecke nicht die Sorge um die Sprache, sondern der Einsatz gegen Minderheiten. Indem man die Sprache nicht „inklusiv“ mache, bekämpfe man die Gleichstellung. Die geistige Mutter der Initiative, die SVP-Kantonsrätin Susanne Brunner, macht also gewissermaßen mobil gegen ihr eigenes Geschlecht. Warum sie das tun sollte, bleibt ein ungelöstes Rätsel.
Die Vertreter des „Genderns“ haben derzeit ein großes Problem. Sie wollen mit dem Mittel der Sprache die Geschlechter sichtbar machen. Aber es sind dieselben Leute, die uns gleichzeitig erklären, dass es Geschlechter im bisher verstandenen Sinn gar nicht gebe, dass „Frau“ und „Mann“ nur gesellschaftliche Konstrukte und nicht die Realität seien. Erstaunlich, mit welcher Vehemenz die Abschaffer der Geschlechter an einer geschlechtergerechten Sprache arbeiten.
Zahlen widerlegen die These
Über Jahre wollten sie uns zudem einhämmern, das generische Maskulinum führe zu Zerrbildern im Kopf. Das Patriarchat wird gewissermaßen durch die Sprache zementiert. Wenn es nur „Ärzte“ statt beispielsweise „Ärzt*innen“ heiße, kämen Mädchen gar nicht erst auf die Idee, Medizin studieren zu können.
Was sie aber gemessen an nackten Zahlen durchaus tun: Seit über 20 Jahren liegt in der Schweiz der Anteil der Frauen, die ein Medizinstudium absolvieren, höher als derjenige der Männer. Abgesehen von vereinzelten Disziplinen sind Frauen in medizinischen Berufen meist in der Überzahl. Dort, wo sie es nicht sind, ist das selbstgewählt. Chirurgie beispielsweise steht bei Frauen nicht hoch im Kurs. Sich darauf zu spezialisieren, verbietet ihnen aber niemand.
› Folgen Sie uns schon auf Instagram oder LinkedIn?
Die generelle Aussage, dass Gendersterne und Doppelpunkte eine Art willkommene Umprogrammierung des Hirns zugunsten der Gleichberechtigung auslösen, kann nur schon angesichts des kurzen Zeitraums, in dem sie angewendet werden, wissenschaftlich nicht fundiert sein. Aber darum geht es der Sonderzeichen-Fraktion wohl gar nicht. Denn der Vorwurf an die andere Seite, wonach der Kampf gegen diesen Eingriff in die Sprache politisch motiviert sei, fällt auf deren Absender zurück. Sie wollen ihre Vision einer nichtbinären Welt in der Sprache verankern, indem sie diese bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln.
Leichte Sprache hier, Verhunzung dort
Was übrigens, wenn man der Autorin bei tsüri.ch glaubt, auch nicht weiter schlimm ist. Sie schreibt: „Sprache ist Ästhetik egal“. Was für eine Aussage von jemandem, der mit der Sprache arbeitet. Und weiter: Es sei völlig egal, wenn Wörter „holprig, sperrig oder mühsam daherkommen“. Das ist vermutlich unfreiwillig ehrlich. Den Stern-Vertretern geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig verstehen. Sie wollen die Sprache zum Instrument ihrer Zeitgeist-Mission machen. Texte sollen zu unlesbaren Ungeheuern im Dienst der politischen Korrektheit werden.
Kleine Ironie am Rande: Die Behörden bemühen sich seit einigen Jahren um eine Kommunikation in „leichter Sprache“, die ohne Fremdwörter, lange Sätze und komplizierte Formulierungen auskommt. Wichtige Informationen sollen so auch Fremdsprachigen oder Leseschwachen zugänglich sein. Parallel dazu wird die Sprache für den großen Rest mit Sonderzeichen aufgepumpt, bis sogar Germanisten verzweifelt zur Version in „leichter Sprache“ wechseln. Ein Widerspruch – aber Widersprüche sind Programm, wenn Weltverbesserer am Ruder sind.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?





Kommentare
Es wäre Zeit, das Gendern endlich ganz einzukassieren, also auch das "kleine Gendern" (immer männlich und weiblich nennen). Die ganze Theorie beruht auf der Falschbehauptung, dass die bisherige Sprache irgendwie diskriminierend sei. Das Ganze hat aber einen größeren Hintergrund: die Verarmung der Sprache. Das ist beileibe nicht nur ein ästhetisches Problem. Es geht darum, dass die verwendete Sprache zunehmend an Präzision verliehrt, ihre Fähigkeit, die Wirklichkeit zu beschreiben und auszudrücken. Gerade wenn man den politischen Bereich bedenkt, verlieren die Begriffe immer mehr an Inhalt und Sinn und werden zu Signalwörtern, um die Gesinnung des anderen einzuschätzen. Die Sprache wird so vereinheitlicht und funktionalisiert. Befeuert wird die Entwicklung noch durch den immer stärkeren Einsatz von KI für Texte. KI formuliert nur allgemein ohne die feinen sprachlichen Nuancen, die für den menschlichen Geist kennzeichnend sind. Durch die Verwendung von Anglizismen wird die Sprache auch kälter. Sie drückt weniger Identität und Heimatgefühl aus. Die Sprache wird heute also von vielen Seiten bedroht. Das Ende der Entwicklung könnte sein, dass es gar nicht mehr möglich ist, Missstände und Probleme überhaupt angemessen auszudrücken, da einfach die Ausdrucksmöglichkeit fehlt. Eine Möglichkeit sich hier zu widersetzen kann sein, sich nicht dem Druck heutiger sprachlicher Moden zu beugen, einfach die Sprache zu verwenden, mit der man sich wohlfühlt. Es ist möglich, von anderen verstanden zu werden, auch wenn man nicht ganz dieselbe Sprache spricht.
Kommentar eines Freundes: "Genial, zwei Sätze, die Goethe, Hölderlin & Co. besänftigen werden. Sie drehen sich seit einiger Zeit im Grab um."
Diese ganz unwiderstehlich formulierte Kolumne verlinke ich oft im Freundeskreis, und jener Freund erinnert mich eben an diesen herrlichen Beitrag vom 27.12.2022: https://www.corrigenda.online/politik/minderheiten-beduerfnisse-ueber-n…
Für die Zürcher Entscheidung drücken wir alle Daumen!
@Helene Dornfeld Der von Ihnen angegebene link 27.12.2022: https://www.corrigenda.online/politik/minderheiten-beduerfnisse-ueber-n… lässt sich nicht öffnen, Bitte an die Redaktion, den Zugang zu öffnen, der Titel macht neugierig.
Kälte will ich den Anglizismen nicht unterstellen. Sie können nichts für die Unbedarftheit mancher Mitmenschen. Engländer schmunzeln über deutsche Kreationen. Aber ich stimme zu. Bestimmte Wörter signalisieren Zugehörigkeit zur angesagten Gruppe. Oder den Ausschluss, wenn man sich der Mode verweigert, z.B. dem Gendern. Wer die Macht hat, ordnet fehlerhaften Sprachgebrauch an. Dass Schulen und Universitäten sich das diktieren lassen ist beschämend.
Manchmal sehe ich den Parlamentssitzungen zu, die im TV übertragen werden. Dort war kürzlich eine Ansprache in norddeutschem Platt zu hören, ganz verständlich und sympathisch aufbereitet. Vielleicht darf man als Christ hoffen, dass Fliehkräfte in die eine Richtung immer auch Zugkräfte in die entgegengesetzte Richtung freisetzen.
Zu schade, die Zürcher bleiben beim Gendern,
und die Basler sagen Ja zum ESC,
aber einen Versuch war es wert!