„Der Westen muss eine ideelle Festung werden“

Sehr geehrter Herr Kraus, Sie sind Jahrgang 1949 und haben als Kind den Wiederaufbau Deutschlands miterlebt, später die Verwandlung Bayerns von einem Agrar- in ein modernes Industrieland. Würden die heutigen Deutschen ein zerstörtes Land wieder aufbauen können?
Da habe ich meine erheblichen Zweifel. Denn wir haben, auch wenn es nach wie vor tolle, wunderbare junge Leute und junge Erwachsene gibt, heute eine Generation, die es verlernt hat, Verzicht zu üben und sich auch über längere Zeit hin anzustrengen, bis der Erfolg kommt. Das ist meine Erfahrung aus 75 Jahren Biografie. Ich habe bis vor kurzem immer stolz gesagt: Ich bin so alt wie die Republik, ich bin so alt wie das Grundgesetz. Was natürlich nicht heißt, dass ich nur ein Verfassungspatriot wäre. Denn nur Verfassungspatriot zu sein, das würde das Gleiche sein, wie wenn einer das Fußballspiel deshalb liebt, weil die Regeln so gut sind. Aber in diesen 75 Jahren habe ich natürlich das Auf und leider auch das Ab, die Stabilität, aber auch die Bedrohungen einer Republik erlebt, soweit ich zurückdenken kann. Es sind natürlich keine 75 Jahre bewusste Erinnerung, aber spätestens mit meiner Einschulung 1955 in München setzt die bewusste Erinnerung ein.
Erinnern Sie sich an die Stimmung jener Jahre, also als Sie heranwuchsen, als Sie erwachsen wurden? Inwiefern unterscheidet sich das Lebensgefühl damals von dem heute?
Meine früheste Erinnerung hat mit der Einschulung 1955 zu tun. Ich bin in Obersendling im Süden von München aufgewachsen. Es gab noch die Kriegsruinen ringsum. Es waren an vielen Gebäuden, auch an der Schule, die großen weißen Pfeile zu den Luftschutzbunkern. Das war so ein prägendes Erlebnis. Und natürlich hat man die Eltern gefragt: Woher kommt das alles? Und mein Vater, der den Krieg überlebt hat, sonst wäre ich ja nicht da – er war ja vier Jahre an der Ostfront vor dem damaligen Leningrad –, er hat sich die Erlebnisse immer ein bisschen aus der Nase ziehen lassen, weil er doch, das musste ich später feststellen, traumatisiert war. Aber es war trotz allem, trotz aller Erinnerung, die uns Kinder geprägt hat, es war ein Voran.
Dieses Voran haben wir, hab’ ich als Zwölfjähriger dann das erste Mal zerbrechen sehen 1961 mit dem Bau der Mauer am 13. August. Wir waren in den Ferien bei den Großeltern aus Gastwirtschaft und Landwirtschaft – das war Bayern, die amerikanische Besatzungszone, es gab viele US-Soldaten hier, und wir haben die aufmarschieren sehen, und wir hatten 1961 das erste Mal Kriegsangst als Kinder. Wir haben beobachtet, wie die Eltern Hamsterkäufe gemacht haben. Ein Jahr später mit der Kubakrise wieder das gleiche Entsetzen bei den Eltern.
Und dann, 1968/69, als junger Erwachsener, ich hatte gerade eben Abitur gemacht, wieder eine heftige Bedrohung von außen durch den Sowjetkommunismus: der Einmarsch von 500.000 Soldaten des Warschauer Paktes – ohne DDR-Soldaten, die standen Gewehr bei Fuß im Erzgebirge – in die Tschechei, Tschechoslowakei, nach Prag. Ich war junger Soldat. Wieder ein sehr heftiges Bedrohungsgefühl. Aber gleichzeitig ist bei mir auch aus meinem Dasein als Soldat – ich war bei der Luftwaffe – die Überzeugung entstanden: Wir müssen ein Land sein, das in hohem Maße selbst verteidigungsfähig ist.

Trotz Bedrohungen: Es gab immer wieder einen Ausblick, und das hat mich auch nach meiner Zeit als Soldat in meinem Studium sowohl für das Lehramt wie auch für das Diplom in der Psychologie geprägt. Und ab dieser Zeit, 1968/69, bin ich auch zu einem sehr politischen Menschen geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil ich an der Universität, selbst in einer relativ braven Universität wie Würzburg, die Umtriebe und die Ideologie der Achtundsechziger, im Grunde genommen die verkappten Sozialisten und Kommunisten, erfahren habe.
Haben Sie an der Universität in Würzburg während Ihrer Studentenzeit, später als Lehrer am Gymnasium so etwas wie marxistische Umtriebe wahrgenommen? Haben Sie da in Diskussionen eingegriffen?
In meiner eigenen Schulzeit habe ich das nicht erlebt. Da habe ich eher Lehrer gehabt, die ein bisschen zu viel zurückgeblickt haben. Gut, psychologisch verständlich, es waren Lehrer, hauptsächlich männliche Lehrkräfte, die auch Soldaten im Weltkrieg waren. Selbst als ich dann Lehrer wurde, ab 1978 als Referendar und dann 1980 als Studienrat, habe ich das nicht erlebt in den Schulen. Mein großes Glück war, dass ich meinen Lehrerberuf und die Ausbildung dazu in Bayern absolvieren und in den Lehrerberuf einsteigen konnte und nicht in West-Berlin oder in irgendeinem tiefrot regierten Land wie damals Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Die hessischen beziehungsweise niedersächsischen Rahmenlehrpläne, das war im Grunde genommen ja Antikapitalismus, Antiamerikanismus und Sozialismus pur.
In Bayern gab es das nicht. Auch wenn es da und dort gewisse Hochburgen gab, wo sich linke Lehrer zusammengesammelt haben. Aber im Wesentlichen war Bayern ein bildungspolitisch bürgerlich-konservativ, christlich ausgerichtetes Land. Wir hatten Kultusminister wie einen Hans Maier beispielsweise, einen der letzten großen intellektuellen Köpfe, die wir in der Kultusministerkonferenz hatten. Mittlerweile, muss man sagen, hat sich das leider ein bisschen verwischt in Richtung woke Pädagogik und Diversity, Inklusion und Gender. Aber davon blieb ich relativ unbehelligt.

Und 1995 – das war übrigens das Jahr, wo ich beinahe hessischer Kultusminister geworden wäre; sehr zur Überraschung der linken hessischen Presse 1995 hat das damals mit dem Einstieg in die Politik nicht geklappt –, wurde ich dann Leiter eines Gymnasiums. Es ist ein bayerisches Gymnasium gewesen im Landkreis Landshut, sehr ländlich geprägt, da musste ich mir kein Kopfzerbrechen machen um linke Eltern, Schüler und Lehrer. Das waren vielleicht ein oder zwei Mitglieder des Kollegiums, die Mitglieder bei der linken Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft waren. Also da konnte ich schon meine pädagogischen, meine weltanschaulichen Überzeugungen, ohne zu indoktrinieren, vorleben.
Heute hat man vielfach den Eindruck, dass der Kommunismus sich nicht mehr rot kleidet, sondern ein grünes Gewand sich umgelegt hat.
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Für mich ist der Wokeismus eine neue Form von Totalitarismus, wie wir überhaupt in Deutschland seit spätestens den Achtundsechzigern nicht mehr die verschiedenen Formen von Totalitarismus sehen wollen. Wir wollen immer nur den rechten, den faschistischen, den nationalsozialistischen Totalitarismus sehen. Die Totalitarismus-Debatte war in Deutschland nicht beliebt, weil man behauptet hat – Sie kennen den Historikerstreit –, das wäre eine Relativierung des Nationalsozialismus, wenn man auch den Kommunismus unter die Überschrift Totalitarismus packt.
Josef Kraus – zur Person
Josef Kraus, Jahrgang 1949, arbeitete als Gymnasiallehrer und Schulpsychologe und war von 1995 bis 2015 Oberstudiendirektor eines bayerischen Gymnasiums. Dreißig Jahre lang war er (bis 2017) ehrenamtlich Präsident des Deutschen Lehrerverbandes mit rund 160.000 Mitgliedern. Schon früh kritisierte er die Rechtschreibreform, so 1993 vor der Kultusministerkonferenz. Im Landtagswahlkampf 1995 stand Kraus für den damaligen hessischen CDU-Spitzenkandidaten und ehemaligen Bundesinnenminister Manfred Kanther in dessen Schattenkabinett als Kultusminister bereit. Von 1991 bis 2013 gehörte Kraus dem erstmals 1958 durch den damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß einberufen Beirat für Fragen der Inneren Führung des Bundesverteidigungsministers an. Er ist Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung für Familienwerte e. V. in Trier. 2009 wurde Kraus das Bundesverdienstkreuz verliehen. Kraus ist vielfältig und vielerorts publizistisch aktiv und als gefragter Vortragsredner unterwegs. Seine Streitschrift „Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt“ (2017) ist unter seinen zahlreichen Büchern („Spaßpädagogik“, „Der Pisa-Schwindel“) vielleicht das bekannteste. Wehrpolitisch Interessierten sei die Gemeinschaftsarbeit mit Richard Drexl empfohlen: „Nicht einmal bedingt abwehrbereit“. Kraus lebt mit seiner Frau in Ergolding bei Landshut.
Wir haben heutzutage vier Formen von Totalitarismus, historischen oder auch präsent gegenwärtigen. Das ist natürlich der nationalsozialistische oder der faschistische – wobei die beiden Begriffe zu Unrecht gleichgesetzt werden, aber Stalin wollte ja nicht, dass der Begriff Nationalsozialismus vorkommt, weil da „Sozialismus“ drinsteckt. Dann ordnete er Anfang der dreißiger Jahre während einer Komintern-Tagung an, dass nicht mehr von Nationalsozialismus gesprochen werden dürfe, sondern nur noch von Faschismus. Das zweite ist der Kommunismus. Das dritte, auch das ist Totalitarismus, das ist der politische Islamismus. Und das vierte ist jetzt der Wokeismus, der versucht, über Sprachregelungen, die letztendlich Denkregelungen sind, den Menschen total zu prägen und zu indoktrinieren.
„Die Kirchen müssen sich wieder auf ihren seelsorgerlichen Auftrag besinnen“
Heute haben wir die Situation, dass die Kirche vielfach als Teil des Systems empfunden wird, immer weniger als ein belebender Widerpart. Erinnern wir uns nur an das beschämende Mitmachen der Bischöfe beim Corona-Regime. War das mit der Kirche in Ihrer Jugend noch anders?
Die Kirchen haben in der Coronazeit versagt. Die Kirchen haben sich gebeugt dem angeordneten Verzicht auf Gottesdienste, sie haben verzichtet auf das Singen von Liedern, auf die Seelsorge in Seniorenheimen, auf die Begleitung der Senioren, die einsam sterben mussten. Da haben die Kirchen versagt. Aber das ist nur ein Punkt. Und wenn Sie rekurrieren auf meine Erfahrungen – ich bin in einem katholisch geprägten Elternhaus aufgewachsen mit meinen zwei jüngeren Brüdern. Meine Eltern waren, soweit ich mich erinnern kann, katholisch geprägt. Meine Mutter hat in einem Kirchenchor gesungen, mein Vater hat die Kirchenorgel gespielt, und für uns war es wie selbstverständlich und ist bis heute eine bleibend schöne Erinnerung, dass man die Erstkommunion, dass man die Firmung gefeiert hat, dass man kirchlich geheiratet hat usw. mehr.
Ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich bis zu meinem zwölften Lebensjahr in München aufgewachsen bin, in einer Diözese, in der es noch keinen Kardinal Marx, sondern einen Kardinal Döpfner gab, und dann im Bistum Eichstätt, wo mein Vater der Gründungsdirektor einer Katholischen Pädagogischen Hochschule war. Das alles ist auch der Grund, warum ich mit meiner Frau zusammen trotz aller Kritik auch an der katholischen Kirche – das hat nicht nur mit dem Missbrauch etwas zu tun – nicht aus der Kirche ausgetreten bin, weil wir beide sagen, wir sind es unserer Prägung und auch unseren Eltern schuldig.
Das heißt nicht, dass wir den Kirchen, der evangelischen und der katholischen, nicht äußerst kritisch begegnen. Wenn ich mir die Programme der Kirchentage anschaue – Genderismus, Queer-Themen usw., inflationär spielen sie eine Rolle –, wenn ich mir anschaue, wer dort ein Podium bekommt, und wenn ich an den Evangelischen Kirchentag vom Juni 2023 denke, wo die Abschlusspredigt in den Satz mündete: Gott ist queer!, dann muss ich sagen, das sind nicht mehr meine Vorstellungen von christlicher Kirche. Wenn ich mir anschaue, wie damals der führende katholische Bischof in Deutschland, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, und der damalige Spitzenmann der Evangelischen Kirche Deutschlands, Heinrich Bedford-Strohm, in Jerusalem das Kreuz abgelegt haben! Wenige Jahre, nachdem Papst Benedikt in der Blauen Moschee in Istanbul das Kreuz nicht abgelegt hat! Da muss ich sagen, dann ist das für mich ein Symbol von Selbstverleugnung.
Was glauben Sie, woher kommt das? Was sind die Quellen dieser Angleichung an die Welt? Dieses wachsweichen Mitmachens?
Man will natürlich der Politik gefällig sein. Vielleicht, weil man – das wird nicht ausgesprochen, das unterstelle ich mal –, weil man Angst hat, dass es mit der Kirchensteuer schwieriger wird oder dass ein völlig säkularisiertes Deutschland über kurz oder lang die Kirchensteuer abschafft; Bestrebungen in die Richtung aus politischen Ecken gibt es ja. Aber ich schließe nicht aus, dass irgendwann einmal eine so oder so geartete Politik in dieser oder jener Konstellation sagt: Mittlerweile sind weniger als 50 Prozent der Deutschen noch in eine Kirche eingeschrieben. Da ist eine Kirchensteuer als Pflichtsteuer nicht mehr von dieser Welt. Das kann vielleicht eine Rolle spielen.
Ansonsten war Kirche, evangelische Kirche noch mehr als katholische, immer mal wieder bestrebt, die Nähe zu den Regierenden zu suchen. Beginnend mit Luther, der nicht ganz zu Unrecht als Fürstenknecht bezeichnet wurde. Fortgesetzt durch den ein oder anderen, Gott sei Dank nicht in der Mehrheit, katholischen Bischof, Adolf Bertram etwa, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in der NS-Zeit. Und dann das Ganze hinein in die DDR – eine sehr systemnahe Evangelische Kirche. Und jetzt wieder eine Systemnähe der offiziellen Kirchen. Wobei ganz gewiss auch eine Rolle spielt, dass bis hinauf in Bischofsränge und natürlich in die Laienorganisationen – schauen Sie sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken an mit dem Herumeiern in der Abtreibungsfrage usw. – die Märsche durch die Institutionen stattgefunden haben. Bis zur Berufung von linken Theologieprofessoren an den Universitäten, die natürlich dann die Diplom-Theologen bzw. die angehenden Priester ausbilden und formen.
Da bin ich mittlerweile einer, der, obwohl er keine französischen Verhältnisse haben möchte, etwas mehr Distanz, etwas mehr Säkularisierung zwischen den Regierenden und den Kirchen haben möchte. Die Kirchen müssen sich wieder auf ihren spirituellen und seelsorgerlichen Auftrag, den trostspendenden, den zukunftsweisenden Auftrag besinnen.
„Bei der Familie eine Entwicklung wie nach dem ‘Kommunistischen Manifest’“
Haben Sie Erinnerungen an die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, an die Einführung des neuen Messritus, den Umbau der Altarräume infolge der Liturgiereform?
Natürlich erinnere ich mich an die Reformen des Zweiten Vatikanums. Wobei für mich jetzt die neuen Ausrichtungen am Altar und wo der Priester stand usw. das weniger Entscheidende waren. Da ich ein humanistisches Gymnasium besucht habe, habe ich es genossen, die lateinische Messe zu erleben, weil man sich selber ja auch testen konnte, hej, verstehst du das jetzt auch alles schon als einer, der im ersten oder im zweiten oder dritten Lateinjahr war. Das habe ich ein bisschen bedauert. Und ich glaube, dass durch das Zweite Vatikanische Konzil, das übrigens bekanntermaßen ja auch sehr geprägt war von Kardinal Frings und seinem Zuarbeiter Ratzinger, ein Stück Geheimnisvolles verlorengegangen ist.
Sie haben in Ihrem neuen Buch die Familie ein Auslaufmodell genannt. Sie haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend auch noch als Wirtschaftsgemeinschaft erlebt. Wenn man die Familie ein Auslaufmodell nennt, so könnte ich provokativ dagegenhalten vor dem Hintergrund unseres umfassenden Sozialstaates: Verhalten sich die Bürger denn nicht einfach nur rational? Die Familie wird heute vielfach als nicht notwendig erlebt. Man kommt ja ohne sie durchs Leben, bei Not und Krankheit fängt einen das Netz des Sozialstaates auf.
Meine Mutter stammte noch aus der Landwirtschaft, ja. Aber Familie als Auslaufmodell? Das ist meine besorgte Diagnose oder Prognose, nicht meine Zielvorstellung. Wenn Sie sagen: Familie als Wirtschaftsgemeinschaft – ich würde dazu sagen, nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Verantwortungsgemeinschaft. Und das ist heute vielfach hops gegangen.
Beziehungsweise diese Verantwortungsgemeinschaft, die auch die Wirtschaftsgemeinschaft mit einschließt, das wirtschaftliche Sorgen füreinander, wird ja nun mehr und mehr delegiert an Vater Staat. Nach dem Motto: Wenn es schiefgeht – und es geht ja oft genug und immer häufiger schief –, das soziale Netz, Vater Staat, fängt die schon auf. Der sorgt schon dafür, wenn die Familie zerbricht, wenn sich Eltern scheiden lassen, dann kann der alleinerziehende Elternteil, in 80, 85 Prozent der Fälle ist es die Mutter, sich darauf verlassen, dass die Kinder dann von Vater Staat in Ganztagsbetreuung übernommen werden, damit man selbst, nachvollziehbar, finanziell über die Runden kommt und ein oder eineinhalb Jobs annehmen kann. Auslaufmodell Familie hat natürlich viele Gründe und viele Aspekte ...
Nennen Sie uns bitte welche.
Die Familien werden immer kleiner. Wir haben 1,3 Kinder pro Frau in Deutschland. Übrigens bei Frauen mit höherem Bildungsabschluss oder mit Studienabschluss nur von 0,8. Wir haben hohe Scheidungsraten. Die Ehen werden immer später geschlossen. Das Durchschnittsalter einer Frau bei der Geburt des ersten Kindes war lange Zeit 22, 23, 24, ist jetzt bei 30, 31 angekommen. In der Folge natürlich, wenn das erste Kind mit 32 oder bei Spätgebärenden mit 38 kommt, dann ist oft keine Zeit mehr, rein biologisch, für ein zweites oder drittes Kind.
Ein Symbol für die Labilität unserer Familien ist auch das neue Namensrecht. Der gemeinsame Name ist zwar noch in der Mehrzahl der Familien üblich, und er ist ja auch ein wichtiges symbolisches Bindeglied. Aber das neue Namensrecht macht es möglich, dass Papa anders heißt als Mama; bei Wiederverheiratungen sowieso. Es haben sich die Bindungen gelockert. Und im Grunde genommen ist dadurch eine Entwicklung zustande gekommen, wie sie Karl Marx 1848 mit dem „Kommunistischen Manifest“ haben wollte – wir müssen, frei übersetzt, die Familien zerschlagen, weil die Familien Hort des Widerstandes gegen unsere Vorstellungen von kommunistischer Gesellschaft sind.
Dann gräbt doch eigentlich der Sozialstaat der Familie als Verantwortungsgemeinschaft das Wasser ab.
Ja, er gräbt ihr das Wasser ab, weil leider zu viele aus Bequemlichkeit heraus die Segnungen des Sozialstaates in Anspruch nehmen und gern auch Erziehung an den Staat delegieren. Was glauben Sie, was ich da in 40 Jahren Tätigkeit als Schulleiter, als Lehrer, als Schulpsychologe erlebt habe! Jetzt mal sehr verkürzt, anekdotisch erzählt.
Geben Sie mal ein Beispiel bitte, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist.
Kommt eine Mutter zur Sprechstunde: Herr Kraus, erklären Sie mal meiner Siebtklass-Tochter, dass sie weniger mit dem Handy unterwegs sein soll. Oder ein Vater: Meinem Sohn, dass er weniger Pornografie anschauen soll. Nun tut allerdings offizielle Pädagogik auch so, als könnte das alles vom Staat übernommen werden. Anderes Beispiel: Es werden der Schule ja immer neue Bindestrich- und Segmentpädagogiken aufs Auge gedrückt – Freizeit-Erziehung, Gesundheitserziehung, Ernährungserziehung, Klimaerziehung natürlich neuestens. So dass viele Eltern dann das Gefühl haben: Okay, da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern, die werden in der Schule schon gesagt bekommen, wie man sich ernähren soll, wie man die Freizeit gestalten soll. Es ist im Grunde eine Entmündigung von Eltern, die der Staat da bietet. Es ist das, was der damalige Generalsekretär der SPD, ein gewisser Olaf Scholz, ja schon 2002 vom Stapel ließ: Wir brauchen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Ich bin überzeugt davon, dass er heute noch so tickt.
Aber diese Lufthoheit über die Kinderbetten hat der Staat mehr und mehr an sich gerissen. Meine Frau und ich sind jetzt Großeltern. Wir schütteln nur noch den Kopf, wenn beispielsweise einer unserer Enkel, damals vierjährig, aus dem Kindergarten kommt, wo ich ihn abgeholt habe, und zu mir sagt: Opa, ich weiß jetzt, was veganes Essen ist. Oder ein Enkel erklärt, was man tun soll, damit das Klima gerettet wird. Wir haben hier eine Indoktrination, eine Entmündigung von Eltern. Viele Eltern versuchen dagegen anzugehen, relativ erfolglos.
„Unlust an Kindern eine Folge materialistischer Lebenshaltung“
Können Sie sich erinnern, ab wann das war, dass ein Zusammenleben ohne Ehe – wilde Ehen, Beziehungskisten – allgemein akzeptiert wurde? Haben Sie da ein Schlüsselerlebnis?
Nein, ein direktes Schlüsselerlebnis habe ich nicht, auch wenn ich dann ab den 80er Jahren auch im Bekannten- und Verwandtenkreis zerbrochene Ehen und Scheidungen, Scheidungswaisen erlebt habe. Letztendlich hat sich das angebahnt mit den Achtundsechzigern, angebahnt auch mit der Pille. Sexualität war nicht mehr gebunden an die Ehe. Dann natürlich die zum Teil notwendigen Entwicklungen in Richtung Selbständigkeit, Eigenverantwortung der Frau, aber natürlich auch übersteigert feministisch die Vorstellungen von Selbstverwirklichung. Das hat sich ab den siebziger, ab den achtziger Jahren breitgemacht. Aber da haben wir ja auch den ganz tiefen Einbruch, was die Kinderzahlen betrifft. Dann ein liberalisiertes Scheidungsrecht. Mittlerweile haben wir mindestens zwei oder gar drei nachwachsende Generationen, die diese Destabilisierung von Familie miterlebt haben.


Die Unlust an Kindern. Was glauben Sie, woran liegt das vor allem? Gibt es eine Hauptursache, die Sie ausmachen? Selbst nach Kriegen haben sich die Bevölkerungszahlen rasch wieder erholt. Auch während des Zweiten Weltkrieges sind noch viele Kinder geboren worden.
Wenn Sie sich die Geburtsjahrgänge anschauen, also 1943, ’44, ’45 – das waren ja geburtsmäßig keine Totalausfälle! Aber das ist eine Entwicklung, die nicht nur Deutschland, sondern das gesamte Europa betrifft. Auch die ehemals kinderfreundlichen südeuropäischen Länder sind in den Kinderzahlen zum Teil noch unterhalb von dem, was wir in Deutschland mit 1,3 haben. Das einzige große westliche Land, das noch eine Geburtenzahl deutlich über zwei, ich glaube 2,6 hat, sind die USA. Und um eine ausgewogene Bevölkerungspyramide zu haben, braucht man eine Geburtenzahl pro Frau von circa 2,1 bis 2,2. Da sind wir weit davon weg.
Was ist die Ursache, woher kommt die Unlust an Kindern? Denn sich weitergeben zu wollen, auf Enkel schauen zu können, das ist doch eigentlich etwas menschheitlich Gegebenes.
Es ist eine Mentalitätsfrage oder auch eine Frage der Ideenwelt oder auch der Ideologie. Es ist die Folge materialistischer Lebenshaltung: Ich will genießen, ich will Karriere machen. Und da sind Kinder nur ein Hemmschuh. Sehr schön auf den Punkt gebracht hat es der frühere Kardinal Joseph Ratzinger. Er hat es auch trefflich formuliert in seiner Rede unter der großen Überschrift „Diktatur des Relativismus“, beim Konzil 2005, bei dem er dann zum Papst gewählt wurde, dass nichts mehr zählt, dass alles gleich gültig ist und, dann zusammengeschrieben, auch gleichgültig ist. Da hat er gesagt: Es geht in Europa eine seltsame Unlust um, was die Zukunft betrifft. Man kann es daran ablesen, dass die Kinder als Grenze der Gegenwart gesehen werden und die Gegenwart aber ausgerichtet ist auf Genuss ohne Reue, Genuss sofort.
Es ist die Fixierung breiter Bevölkerungsschichten auf das Hic et nunc, auf das Hier und Heute, ohne zu berücksichtigen, dass dieses Gemeinwesen, dass dieses Volk nur eine Zukunft hat, wenn es auch für den entsprechenden Nachwuchs sorgt. Und das geschieht nicht. Und da wird man seitens der Politik damit getröstet, dass man sagt: Wir lösen das über Zuwanderung. Diese Zuwanderung bedeutet natürlich auch eine dramatische Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung und letztendlich auch eine dramatische Veränderung des Bildes von Mensch, Familie und Gesellschaft.
„Finnen und Schweden, die haben es kapiert“
Wir sprachen vorhin von der Verantwortungsscheu, der Scheu, Verantwortung für eine Familie, für den Ehepartner, für die Kinder zu übernehmen. Verantwortungsscheu haben wir auch, wenn wir auf die Verteidigungspolitik unseres Landes schauen. Sie haben ein enges Verhältnis zur Bundeswehr, weil Sie 22 Jahre lang Mitglied im Beirat des Verteidigungsministers waren. Sie haben mit einem Kollegen ein Buch über die Schwächen der Bundeswehr geschrieben, mit dem Titel „Nicht einmal bedingt abwehrbereit“. Das ist jetzt fünf Jahre her. Wenn unsere Generation nur auf ihre Gegenwart schaut, genießend im Hier und Heute aufgeht, dann ist so eine Haltung in der Verteidigungspolitik letztendlich tödlich. Denn wenn man keine eigene Armee im Land hat, hat man eine fremde Armee im Land. Was ist, wenn uns eines Tages die Russen angreifen?
Ein hochkomplexes Thema. Die Bundeswehr wurde heruntergewirtschaftet. In Zahlen ausgedrückt: Aus einer Armee mit 495.000 Mann wurde zuletzt eine Armee mit 178.000. Aus einer Armee, die 3.300 Leopard-Panzer hatte, wurde eine Armee mit 300, wovon ein Drittel ständig in Wartung ist.
Den größten Absturz hat die Bundeswehr dann in 16 Merkel-Jahren gemacht, das muss man schon deutlich sagen. Ich mache es fest an einem: Wenn eine Bundeskanzlerin, die im Kriegsfall Oberbefehlshaber wäre, eine militärisch-sicherheitspolitisch völlig ahnungslose Ursula von der Leyen 2013 zur Verteidigungsministerin macht, dann weiß ich, was ein Regierungschef von der Bundeswehr und von der Verteidigungsbereitschaft hält. Man hat es nicht kapiert. Man wollte es nicht kapieren. Russland annektierte 2014 die Krim. Es war absehbar, dass Russland die Finger in die Ostukraine hinüberstreckt und in der Ostsee Szenarien aufbaut gegen die baltischen Länder, gegen Finnland, gegen Schweden.
Die haben es übrigens kapiert: Diese dezidiert und hartnäckig lange Zeit neutralen Länder wie Finnland und Schweden wissen, warum sie in die NATO gegangen sind. Weil die baltischen Länder oder Finnland mit seiner 1.300 Kilometer langen Grenze zu Russland sich unter dem Schutzmantel des NATO-Beistandspakts einigermaßen sicher fühlen können.
Und jetzt haben wir die Situation, dass die Bundeswehr heruntergewirtschaftet ist, dass sie das, was sie noch auf die Beine bringt, zu Recht als militärische Hilfe in die Ukraine schickt. Dass aber über kurz oder lang die Bundeswehr wieder aus dem letzten Loch pfeifen wird. Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die 2022 aufgelegt wurden, sind 2026 aufgebraucht, weil es ja sowieso keine 100 Milliarden mehr waren, sondern aufgrund von Kreditzahlungen und Inflation vielleicht nur noch 85 Milliarden sind. Aber dass dieser naive, oder fast müsste man sagen, militante Pazifismus immer noch um sich greift, sieht man daran, dass im laufenden Haushaltsjahr der reguläre Haushalt der Bundeswehr von 50,4 auf 50,1 Milliarden Euro gekürzt wurde.
Wir müssten, wenn die vollmundigen Versprechungen eines Olaf Scholz mit seiner Zeitenwende-Rede – die Rede wird maßlos überschätzt – sich erfüllten, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgeben für Rüstung. Wir müssten spätestens ab 2026 den regulären Bundeswehrhaushalt von 50 auf 80 Milliarden Euro erhöhen. Die zwei Prozent: Wir brauchen sie! Auch wenn ein paar andere NATO-Länder die zwei Prozent unterschreiten.
Aber ich bin sehr skeptisch, selbst wenn die Bundeswehr jetzt mit Boris Pistorius einen Verteidigungsminister hat, der endlich mal auch in der Truppe anerkannt ist. Wir brauchen da ein gewaltiges Umdenken. Egal wer nun Bundeskanzler ist, auch wenn er Friedrich Merz heißt.
Ein letztes Beispiel noch für den Zustand der Bundeswehr. Es ist doch ein Treppenwitz, wenn die Bundeswehr zur Sicherung der NATO-Ostflanke, konkret der Aufstellung der Brigade Litauen mit 5.000 Mann, drei Jahre braucht, drei Jahre braucht für 5.000 Mann! Um in Litauen ein bisschen ein Verteidigungs- oder Abschreckungspotenzial aufzubauen. Das ist für die Russen, das ist für einen Putin eine Lachnummer, und da brauchen wir drei Jahre dazu. Man kann nur hoffen, dass ein Trump seine Drohung nicht wahrmacht, als er gesagt hat: Wir Amerikaner orientieren uns jetzt wieder – übrigens, das hat auch Obama schon gesagt –, wir orientieren uns jetzt mehr in Richtung indopazifischen Raum und nehmen uns aus Europa zurück, wenn die europäischen NATO-Partner dauerhaft unter den zwei Prozent der Bruttoinlandsproduktausgaben für Militär bleiben.
Angesichts der gigantischen Rüstungsproduktion Russlands, die nach Informationen unseres Verteidigungsministeriums in drei Monaten so viel Rüstungsgüter produzieren wie die gesamte Europäische Union in einem Jahr: Sind zwei Prozent nicht noch wenig? Von unserer schwachen Verteidigungsbereitschaft, von der auch der Feind weiß, ganz zu schweigen.
Zunächst muss natürlich das Geld her. Dann muss die deutsche Rüstungsindustrie wieder auf die Beine kommen. Sie wurde ja auch mangels Aufträgen heruntergefahren. Unter den größten Rüstungskonzernen der Welt rangieren wir ganz, ganz weit hinten. Auch wenn Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann und Diehl und Hensoldt jetzt etwas aufholen. Aber das Geld allein macht es nicht! Wir brauchen auch wieder Nachwuchs in der Bundeswehr. Wir brauchen ein Wehrdienst- oder Wehrpflichtmodell, so dass wir endlich wenigstens mal die 20.000 unbesetzten Planstellen besetzen können. Dass wir wenigstens in den nächsten drei Jahren die Planstärke von 203.000 erreichen. Oder noch besser, was NATO-Strategen sagen, 270.000.
Nur nochmal zum Vergleich 270.000: Das ist etwas mehr als die Hälfte dessen, was die Bundeswehr noch 1989, 1990 hatte; jetzt mal gar nicht mitgerechnet, die Armee wurde ja weitestgehend abgewickelt, die knapp 200.000 Mann der Nationalen Volksarmee. Generalleutnant Alfons Mais, der Inspekteur des Heeres, hat gesagt: Wir sind blank. Wir haben für eine größere militärische Auseinandersetzung nur Munition für zwei oder drei Tage! Nein, wir können uns nicht nur auf die anderen verlassen, aber wir brauchen nach wie vor und wahrscheinlich auf längere Sicht, hoffentlich auch unter US-Präsident Trump, den atlantischen Schutzschirm.
„Pistorius hat mit seinem Begriff der ‘Kriegstüchtigkeit’ nicht Unrecht“
Nur – Hoffen und Harren macht manchen zum Narren …
Der Spruch hat natürlich seine Bedeutung. Aber noch schlimmer ist dieser naiv-militante Pazifismus nach dem Motto „Das wird schon gutgehen“. Und dann fahren ein paar AfD-Putinversteher nach Sotschi und nach Moskau, und da besteht eine Ex-Kommunistin Wagenknecht darauf, dass in Landeskoalitionsverhandlungen Friedensformeln mit eingepackt werden. Nein. Die Leute haben vergessen, was die alten Römer schon wussten: Si vis pacem para bellum, wenn du den Frieden willst, dann musst du für den Krieg gewappnet sein! Insofern hat Pistorius mit seinem Begriff, der vielen nicht geschmeckt hat, mit seinem Begriff der „Kriegstüchtigkeit“ nicht Unrecht. Es wurde höchste Zeit, dass hier Klartext gesprochen wird.
Denn wir hatten in der Merkelzeit Verteidigungsminister, ob das ein Franz Josef Jung, ob das ein Thomas de Maizière, ob das ein Karl-Theodor zu Guttenberg war – da durfte das Wort „Krieg“ nicht vorkommen! Da durfte das Wort „Gefallene“ nicht vorkommen. Die 58 in Afghanistan gefallenen und ums Leben gekommenen deutschen Soldaten – die Amerikaner hatten über 3.000 gefallene Opfer – durften nicht Gefallene genannt werden. Der Friedenshain, den die Angehörigen von in Afghanistan gefallenen Soldaten aufgebaut haben, der ist irgendwo versteckt in einer Kaserne in der Nähe von Potsdam. Jwd, würden die Berliner sagen, janz weit draußen. Man behauptet, Deutschland sei eine Parlamentsarmee. Warum wird so was nicht in der Nähe des Parlaments aufgebaut, in der Nähe des Reichstags? Da ist vieles einfach schizophren.
Sind das alles Dekadenzphänomene, Herr Kraus? Von der Dekadenz spricht auch Ihr Buch.
Natürlich. Es gibt viele Dekadenzphänomene, und man reduziert meistens bei der Betrachtung von Dekadenz das Ganze auf das spätrömische Reich, vergisst dabei allerdings, dass das Römische Reich auch 500 Jahre in Blüte stand und für damalige geografische Verhältnisse ein Weltreich war. Aber wenn man sich Hunderte von Kulturen, Dynastien, Machtblöcke, Staatengebilde anschaut, die aus der Geschichte verschwunden sind – Ägypten, das Römische Reich, China unter den Qin und Han, die Maya, Azteken und Inka, die Sowjetunion, die es nicht einmal auf 70 Jahre gebracht hat –, dann findet man ein paar rote Fäden, an denen man festmachen kann, was Dekadenzentwicklungen oder Anzeichen von Dekadenz sind: Zerfall der Familie – darüber haben wir gesprochen. Ein Leben in Luxus – panem et circenses, Brot und Spiele, Wohlstandsverwahrlosung. Das sind solche Anzeichen. Und ganz besonders, auf das will ich hinaus: die mangelnde Bereitschaft, das Eigene zu verteidigen, am Eigenen festzuhalten, es notfalls auch militärisch zu verteidigen, und natürlich das Ganze auch ideell zu verteidigen.

Es gibt renommierte Historiker, meinetwegen den Alexander Demandt, oder Samuel Huntington hat es im Grunde genommen in seinem Buch und seinem Aufsatz „Kampf der Kulturen“ auch so deutlich gemacht, die klipp und klar sagen: Die Gefahren kommen vielleicht von außen, aber die oft größten Gefahren sind die Gefahren von innen, nämlich der Verlust der Selbstachtung und der Verlust der Bereitschaft, das Eigene zu verteidigen.
„Bürgerlichkeit. Ideelle Festung. Westen“
Sie beenden Ihr Buch mit dem Kapitel „Wohin? Am Scheideweg“. Wenn ich Sie frage, wie kommen wir aus der Krise, aus dem Niedergang, aus der Dekadenz wieder heraus, wüssten Sie drei Punkte zu nennen, auf die wir unsere Hoffnung stützen können? Wie kann es wieder besser werden?
Am Ende meines Buches habe ich auch versucht, anhand von 20 kurzgefassten Thesen meine Vorstellung von einer „Leitkultur der Bürgerlichkeit“ deutlich zu machen. Wir brauchen wieder Bürgerlichkeit. Bürgerlichkeit, sprachgeschichtlich tatsächlich im Sinne von Burg, Bürger kommt von Burg. Er verteidigt etwas, der wappnet sich gegen etwas. Bürgerlichkeit brauchen wir wieder.
Dann, das hat mit dem zweiten Punkt zu tun, ich habe das im Buch auch so genannt: der Westen muss eine ideelle Festung werden. Er muss sich darauf besinnen, warum er 500 Jahre lang die Welt geprägt und die Welt auch bereichert hat. Und das dritte? Das war unser letztes Thema in unserem Gespräch: Er muss auch bereit sein, all das, was ihn ausmacht – Demokratie, Bürger- und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit –, bereit sein, notfalls mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Bürgerlichkeit. Ideelle Festung. Westen. Militärische Festung. Das gilt auch gegen eine völlig regellose Zuwanderung, wie wir sie seit 2015 erleben.
Das hört sich ein wenig so an, als ob es vor allen Dingen auf das Wollen der Einzelnen ankomme. Aber gibt es auch gleichsam strukturelle Ursachen? Wenn wir nur auf die jungen Leute schauen, wenn die jungen Leute keine Familien gründen wollen, was soll man tun? Man scheut vor Bindungen zurück. Man lebt in flüchtigen, auseinanderfallenden Beziehungen. Gibt es dafür auch strukturelle Ursachen, an denen man ansetzen muss? Denn so bleibt es gewissermaßen ein Appell an den guten Willen des Einzelnen.
Die strukturellen Verwerfungen sind das Ergebnis von mentalen und ideellen, ideologischen Verwerfungen. Deshalb sehe ich keine Chance, dass man einfach die Strukturen verändert, sondern dass man – und das wird die Aufgabe für eine, mindestens eine halbe Generation –, dass man über Bildung, Bildung in der Familie, Erziehung in der Familie wieder vermittelt, was uns ausmacht: die Kombination aus Antike, Judentum, Christentum. Dass man sich darauf besinnt. Und wenn wir das ignorieren, dann werfen wir über Bord, was in dieser Trias uns ideell und auch materiell reich gemacht hat. Die Bürger- und Menschenrechte gäbe es nicht ohne diese Trias, gäbe es nicht ohne die Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, gäbe es nicht ohne das Prinzip Verantwortung gegenüber einem höheren Wesen. Das müssen wir wieder über Bildung und über Debatten in unseren Familien reinkriegen.
Eine Herkulesaufgabe auch für die Bischöfe, endlich wieder vom Wesentlichen zu sprechen.
Eine Herkulesaufgabe für die Bischöfe, natürlich eine Herkulesaufgabe für die 16 Kultusminister, aber erst einmal – und da finden die entscheidenden Prägungen statt und müssen wieder die entscheidenden Prägungen stattfinden – eine Herkulesaufgabe für Millionen von Eltern und vielleicht auch Großeltern.
Josef Kraus: „Im Rausch der Dekadenz. Der Westen am Scheideweg“, Langen-Müller-Verlag, München 2024, geb., 335 Seiten, 24 Euro
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?
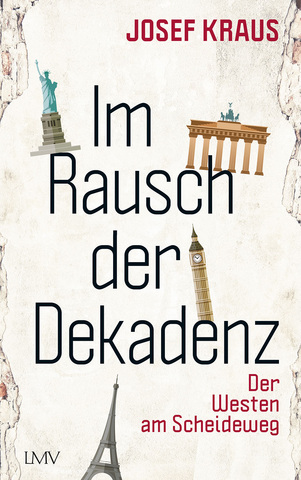





Kommentare
Der romantische Blick zurück auf ein vermutet harmonisches Familienleben in früheren Zeiten hat mit der Realität nicht viel zu tun. Es entsteht der Eindruck, als ob in den Köpfen mancher Leute heute die Idee vom Familienleben nach Art des protestantischen Pfarrhauses mit einem pater familias-Verschnitt als Haupt herumgeistert, wobei das als Gipfel des ehelichen Zusammenlebens in einer Familie verklärt werden soll. Der Film „Das weiße Band“ von Michael Haneke (2009) ermöglicht rückblickend hierzu vertiefende Einblicke und Einsichten in diese Lebensform. Eine rein bürgerliche Existenz war zudem nur einer ganz kleinen Schicht in großstädtischen Milieus möglich, der weitaus größte Teil der Bevölkerung hat immer gearbeitet und zwar Männer wie Frauen. Katholiken hatten immerhin die Möglichkeit der Standeswahl, d. h. ob sie eine Familie gründen wollten oder ob sie den Weg des geweihten Lebens gehen wollten. Nicht wenige Frauen sind sehr gern ins Kloster gegangen, wenn sie es sich leisten konnten, da sie das Drama der Ehefrauen und Mütter in den Familien ja mitbekommen haben. Das Kinderkriegen war für Frauen lebensgefährlich, wie viele Mütter sind im Kindbett verstorben, dann wurde die nächste Frau gesucht zum Heiraten. Wie viele Kinder haben das Erwachsenenalter nicht erreicht, sondern sind an Infektionskrankheiten in jungen Jahren verstorben. Wer nicht ins Kloster konnte oder wollte ging in Stellung und erlernte einen Beruf, Köchin, Schneiderin, Lehrerin oder eröffnete einen Kolonialwarenladen oder verdingte sich als Magd. Und die Männer? Mussten in der Landwirtschaft hart arbeiten und wurden in ständigen Kriegen verheizt, wo sie schwer verletzt wurden oder wo sie fielen.
Das implizite Gedächtnis der Generationen vergisst nicht so schnell. Der technische (Energie) und medizinische (Penicillin) Fortschritt hat die Lebensqualität der Menschen um ein Vielfaches verbessert. So müssen viele früher aus der Not geborene Gemeinschaften heute nicht mehr um jeden Preis erhalten werden. Wer heute eine Familie gründen möchte in einer guten Partnerschaft zwischen Mann und Frau muss ein vertieftes Verständnis finden für die Ehe, das alte (protestantische) Modell hat sich als Keimzelle der Gesellschaft überlebt.
@Dinah Ihr Kommentar hat mich nachdenktlich gestimmt, da ich es eigentlich auch wie Herr Kraus bzw. der Fragesteller sehe. Also eine ernstgemeinte Gegenfrage: Können Sie sich ein realistisches (!) Szenario vorstellen, in dem es dieses tiefe, romantische (?) Verständnis von Ehe auf Dauer und vor allem in der breiten Masse geben kann?
Zum Thema Kirchensteuer und Politik möchte ich folgendes anmerken: Die ist selbst den Gläubigen egentlich nicht mehr vermittelbar: Warum sollte ich als gläubiger Christ Dinge wie das ZdK großzügig finanzieren, die mit den Glaubensgrundlagen nichts mehr am Hut haben? Die sich millionenschwere Showveranstaltungen wie den sogenannten "Synodalen Weg" leisten, die nichts als heiße Luft produzieren, weil diese Veranstaltung - wie von Kirchenrechtlern vorhergesagt - ein kirchenrechtliches Nullum ist und keinerlei Entscheidungskompetenz hat.
Warum sollte ich mit der Steuer eine üppig bezahlte Verwaltungsblase in den Ordinariaten finanzieren (in München rund 1.000 Mitarbeiter), die ständig mit neuen Verwaltungsvorschriften um die Ecke kommt, während für die Pfarreien vor Ort von der Kirchensteuer kaum mehr etwas übrigbleibt, weder für die Seelsorge noch für Bau und Unterhalt der Kirchengebäude?
Bestes Beispiel für den Verwaltungsirrsinn war die sogenannte "Leiterprüfung", die kürzlich in München-Freising durchzuführen war: Sämtliche Leitern mussten katalogisiert werden, mit ausführlicher Beschreibung, wofür die Leiter geeignet ist und wofür nicht. Unser Mesner und Hausmeister hat herzlich gelacht. Vielleicht kommt dieses Jahr dann eine Putzeimerprüfung: Auf jeden Eimer muss ein Aufkleber drauf, wofür er geeignet ist und wofür nicht ...