„Ich liebe Frauen, deswegen möchte ich, dass jede von ihnen geboren werden darf“

Sabina Scherer sitzt in einem ländlichen Gasthof in Oberbayern und nippt an ihrem Cappuccino. Die 35 Jahre alte Mutter, gerade mit dem dritten Kind schwanger, ist selbstbewusst und hat keine Scheu vor Medien und Mikrofonen. Kein Wunder: Seit mehreren Jahren betreibt sie den Podcast „Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung“. Vor vier Jahren war sie in der ZDF-Sendung „13 Fragen“ zu Gast, einer Art Pro und Contra mit mehreren Gästen. Auch wenn sie klar, deutlich und wortgewandt für das Lebensrecht des Menschen in allen seinen Lebensphasen eintritt, in eine Schublade passen mag sie nicht so recht. Sie bezeichnet sich als Apologetin. Ihr Motto: „Pro Woman. Pro Child. Pro Life.“ Die Katholikin nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritik am eigenen Lager geht. „Jede Bewegung braucht Menschen, die auch die eigene Bubble kritisieren“, sagt sie. Corrigenda hat anlässlich ihres Buches „Mehr als ein Zellhaufen“ mit der streitbaren Psychologin gesprochen.
Frau Scherer, was haben Sie gegen Frauen?
(lacht) Absolut gar nichts. Ich liebe Frauen, und deswegen möchte ich, dass jede einzelne von ihnen geboren werden darf.
Ein Teil der Frauen würde Ihnen hier vehement widersprechen, weil Sie in Ihrem Buch schreiben, in einer idealen Gesellschaft gäbe es gar keine Abtreibung mehr, schlicht weil es keine bräuchte. Abtreibung sei ein schwer erkämpftes Recht und ein Teil der Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen, würden sie Ihnen entgegnen.
Das ist eine Frage des Verständnisses von Freiheit, von Selbstbestimmung und der Frage: Was mute ich einem Menschen zu? Ich mute Frauen zu, frei und selbstbestimmt zu sein, ohne die Notwendigkeit zu haben, ihren Nachwuchs töten lassen zu müssen.
Sie bezeichnen sich als Feministin.
Ich habe auf jeden Fall ein feministisch brennendes Herz oder besser gesagt: ein Herz, das für Frauen brennt.
Ist das Provokation, indem Sie einen Begriff der Gegenseite kapern, oder ist das wirklich ernst gemeint?
Es ist schon auch ein Stück weit Provokation, das gebe ich zu. Aber es trifft auch zu. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie man Feminismus definiert, aber ich stimme dem klassischen Feminismus zu 100 Prozent zu. In feministischen Kreisen würde ich trotzdem als stockkonservativ gelten, bewege ich mich in konservativen Kreisen, heißt es oft: Ach, du immer mit deinen feministischen Gedanken!
Was heißt Feminismus für Sie?
Ich verstehe Feminismus als eine Bewegung, die Frauen bestärkt. Aber nicht darin, dass sie gleich sein sollen wie die Männer, sondern dass sie in ihrem Sein, wie sie sind, erblühen können und dass sie sich selbst wertschätzen, ohne dass sie dem Ideal eines Mannes gerecht werden müssen.
Stammen Sie aus einem christlichen Elternhaus?
Ja, ich bin in einem katholischen Haushalt aufgewachsen. Aber trotzdem auch in dieser Welt, ging in eine ganz normale Schule, mit ganz normalen Freunden und an verschiedenen Universitäten, die eine eher liberalere Prägung an ihre Studenten weitergeben. Ich habe also alles mitbekommen, ich lief nicht mit Scheuklappen durch die Welt, und ich habe auch nicht versucht, mein Weltbild zu bestätigen, sondern habe alles aufgenommen und daraus meine eigene Weltsicht entwickelt.
Hat nicht gerade auch der Feminismus dazu geführt, dass es jetzt jährlich mehr als 100.000 Abtreibungen allein in Deutschland gibt?
Sicherlich stimmt das teilweise. Aber es war nicht nur der Feminismus, das waren eine Vielzahl an Faktoren. Der Feminismus, wie er heute verstanden wird, hat nicht nur positive Seiten. Die Idee des Feminismus, die mich interessiert, ist die, die auf Strukturen aufmerksam macht, die schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten bestehen und in die wir irgendwie hineingeworfen sind.
Was meinen Sie damit?
Dass bis vor einigen Jahren Frauen – auch und gerade in christlichen Kreisen – stigmatisiert wurden, die vor der Ehe oder außerhalb der Ehe Kinder kriegten. Daher kam dann auch dieser Gedanke, dass es für Frauen etwas Gutes sei, wenn sie eine Schwangerschaft nicht mehr offenlegen müssten und damit die angebliche Notwendigkeit von Abtreibungen. Die traditionellen Strukturen sind nicht immer nur förderlich für Familie oder für Kinder, sondern haben auch dazu geführt, dass Frauen in schlimme Ehen rein und bleiben mussten. Oder dass sie ausgeschlossen oder ausgegrenzt wurden, weil sie vielleicht durch ein Gewaltverbrechen schwanger wurden. Das wären Beispiele, bei denen ich sagen würde, dass der Feminismus mit dazu beigetragen hat, dass es heute besser läuft.
Haben Sie schon einmal nachgedacht, wie die Abtreibungsdebatte verliefe, wenn Männer Kinder kriegen würden und nicht Frauen?
Es wird gerne so dargestellt, als wäre das dann alles gar kein Thema, weil ja anscheinend dann bei Männern alles total okay wäre. Aber auch wenn Männer Kinder austragen würden, dann wäre es ja genauso falsch, das ungeborene Leben einfach zu beenden. Ich würde dagegen genauso protestieren. Aber wir wissen nicht, wie es sich geschichtlich entwickelt hätte, wie es gesellschaftlich wahrgenommen worden wäre, welche Faktoren da reingespielt hätten.
Sie haben einen Podcast, Sie waren im Fernsehen, und Sie haben ein Buch geschrieben. Sie engagieren sich in sozialen Netzwerken, Sie treten als Speakerin auf und diskutieren leidenschaftlich – immer im Sinne des Lebensschutzes. Was ist der Grund, dass Sie sich ausgerechnet für Lebensschutz einsetzen?
Es ist schon lange ein Herzensthema von mir. Das Thema Abtreibung hat mich irgendwie schon immer gepackt und beschäftigt. Ich glaube, jeder hat ein oder zwei Themen, die einem einfach auf dem Herzen liegen. Dann kam noch hinzu, dass es mich genervt und auch schockiert hat, wie wenig sprachfähig Menschen sind, die pro life sind, gerade in den sozialen Medien. Ich wusste, dass ich da ein Talent habe, dass ich das rüberbringen kann, dass ich da gute Antworten hätte und dass ich wüsste, wie man die formulieren kann, und das wollte ich mit der Welt teilen.
„Da hat es keinen Sinn zu diskutieren“
Ihr Buch hat die Kernbotschaft: Jede Diskussion über Abtreibung mündet irgendwann in die Frage, ab wann ein Mensch ein Mensch und folglich mit Würde ausgestattet und schutzbedürftig ist. Wie will man mit Menschen konstruktiv diskutieren, die behaupten, ungeborene Kinder seien keine Menschen?
Es gibt Menschen, bei denen ich tatsächlich sagen würde, da hat es keinen Sinn zu diskutieren. Wer tief drin ist in der ganzen Thematik, wird zumindest anerkennen, dass es sich beim Embryo um einen lebendigen menschlichen Organismus, um menschliches Leben handelt. Da steht dann die Autonomie der Schwangeren argumentativ sowieso im Vordergrund. Wenn wissenschaftliche Tatsachen aber ohne Zugeständnisse konsequent geleugnet werden, ist fraglich, ob man eine gemeinsame Basis für die Diskussion finden kann. Interessanterweise habe ich die Beobachtung gemacht, dass selbst medizinisch gebildete Menschen der jüngeren Generation im Vergleich zu ihren älteren Kollegen seltener dazu bereit sind, diese Zugeständnisse zu machen.
Das bedeutet, solche Leute stellen sich gegen die Wissenschaft. Warum ist das so und warum kommen sie damit durch?
Ich mag zwar den Begriff nicht, weil man ihn genauso gut auf unsere Seite ummünzen könnte, aber ich kann es nur mit „Ideologie“ erklären. Wenn man einem Kind erklärt, woher der Mensch kommt, wie ein Mensch entsteht, dann weiß jeder, wie das funktioniert und wann dieser Prozess beginnt. Wenn man über ein Wunschkind spricht, dann ist es klar, dass es sich um ein Baby handelt, egal wie klein das ist. Man spricht vom Baby im Bauch und so weiter. Aber wenn es um das Thema Abtreibung geht, dann weiß man das alles plötzlich nicht mehr so genau.
Reicht es nicht, wenn es Medien oder Autoritäten immer wieder vorplappern, dass es sich eben nicht um ein Kind handle?
Worauf sich viele Menschen berufen, ist zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder die UN-Menschenrechtskonvention, nach denen Abtreibung bis zur Geburt legal zugänglich sein sollte und die Menschenrechte erst ab Geburt gelten. Aber warum sollten Menschenrechte erst ab der Geburt gelten? Was ist denn mit den Menschen vor der Geburt? Die allermeisten Menschen würden instinktiv nicht zustimmen, dass ein Mensch im Mutterleib kein Mensch sei und kein Anrecht auf Schutz habe.
Wer sich in sozialen Medien für das Lebensrecht ungeborener Kinder einsetzt, wer schon einmal auf einem „Marsch für das Leben“ war, der wird Hass erfahren haben. Es schlägt einem eine Welle von Beleidigungen und Diffamierungen entgegen. Warum gehen viele Abtreibungsbefürworter gleich von null auf hundert?
Weil es den Kern unseres menschlichen Wesens betrifft. Es betrifft die Themen Freiheit, Sexualität, Fortpflanzung, Intimität. Das sind einige der tiefsten und umkämpftesten Themen überhaupt. Alles, was die Körperlichkeit des Menschen angeht, die Sexualität, die Identität des Menschen. Das ist die eine Ebene. Die andere ist, dass sich Menschen, beim Abtreibungsthema vor allem Frauen, durch solche Diskussionen tatsächlich bedroht fühlen.
Sie sehen sich, ihre Rechte und ihre Freiheit bedroht. Und wenn jemand sich zutiefst bedroht fühlt, dann reagiert er mit solchen Abwehrreaktionen. Da ist es auch egal, ob die Bedrohung real ist oder nicht.
Gegen Gefühle kann man schwer argumentieren.
Es werden halt auch sehr viele Ängste geschürt. Es wird oft so getan, als würden wir kurz vor dem Rückschritt ins Mittelalter stehen. Vor allem beim Thema Fehlgeburten und der Behandlung von Eileiterschwangerschaften werden in unseren Medien krasse Fehlinformationen verbreitet. Es heißt dann oft, wenn in einem Staat Abtreibungen nicht legal seien, dann müsse man aufpassen, ins Krankenhaus zu gehen. Aufgrund dieser medial geschürten Verunsicherung suchen Frauen dann kein Krankenhaus auf und geraten in eine lebensbedrohliche Situation, die nicht sein müsste.
Im US-Wahlkampf haben auch deutsche Medien die Geschichte vom Tod zweier Frauen aus Georgia, die angeblich aufgrund der Pro-Life-Gesetzgebung im US-Bundesstaat Georgia gestorben seien, weiterverbreitet.
In jedem US-Bundesstaat, auch in denen mit eher restriktiven Abtreibungsregelungen, werden Fehlgeburten und Eileiterschwangerschaften behandelt. In den beiden genannten Fällen waren die Ursachen misslungene chemische Abtreibungen. Beispiel Candi Miller: Sie hatte eine schwere Infektion, weil sich weiterhin Gewebe eines Babys in der Gebärmutter befand. Eine Gebärmutterausschabung, so die Medien, hätte ihr Leben wohl retten können. Was sie aber nicht erwähnen: Gebärmutterausschabungen sind in Georgia legal.
„Wie passen Selbstbestimmung und Schwangerschaft zusammen?“
Kommen wir zur zweiten Frage, auf die Abtreibungsdiskussionen fast immer hinauslaufen: die Frage der körperlichen Autonomie der Frauen. Wie passen Selbstbestimmung und Schwangerschaft zusammen?
Mein Wunsch, mein Ideal wäre es, dass jede Frau selbstbestimmt schwanger werden kann. Dass die Schwangerschaft dann eintritt, wenn die Frau bereit dazu ist und wenn sie das möchte.
Und bei einer ungeplanten Schwangerschaft? Ist man denn als Frau immer dazu bereit?
Natürlich nicht. Das zu glauben ginge ja komplett an der Realität vorbei. Eine ungeplante Schwangerschaft sollte in meiner Idealvorstellung keine Katastrophe sein, dafür bräuchte es allerdings noch einige gesellschaftliche Mühen und Entwicklungen. Aber es gibt sie ja bereits jetzt: Frauen, für die eine Abtreibung keine Option ist und die ihr Leben so gestalten, dass eine ungeplante Schwangerschaft kein Desaster wäre. Die die Einstellung haben: Dann muss ich eben einen Weg finden, wie ich dem Kind trotzdem das Leben ermöglichen kann, auch wenn es für mich gerade eigentlich nicht passt. Es ist mir wichtig zu betonen: Schwangerschaft ist ein Thema, das man mit nichts vergleichen kann. Es gibt keine ähnliche, vergleichbare Situation. Und ja, eine Schwangerschaft bedeutet auch eine Einschränkung der Autonomie, im besten Falle eine, die man selbst gewählt hat. Aber wenn nicht, dann ist es trotzdem nicht so, dass man als Schwangere komplett fremdbestimmt wäre.

Die Frage, ob die Schwangerschaft ein Eingriff in die Autonomie der Frau ist, ist gar nicht so banal, weil es sich dabei um einen natürlichen Prozess handelt. Da geht es um die Frage danach, ob die Einwilligung zum Geschlechtsverkehr auch gleichzeitig eine Einwilligung in eine potenzielle Schwangerschaft darstellt. Das ist ein heiß diskutiertes Argument.
Nach der Selbstbestimmung kommt die Frage nach der Verantwortung.
Genau darum geht es dabei. Zunächst die Fakten: Mehr als 99 Prozent aller Schwangerschaften entstehen durch einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Und auch trotz Verhütung kann eine Frau schwanger werden. Dann ein Beispiel: Wenn eine Frau einem Mann ein Kind unterjubelt, sogenannten Samenraub betreibt, dann wird der Mann dazu verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Für den Mann stellt das eine Einschränkung seiner Autonomie da, denn er muss dann so leben, dass er den Unterhalt leisten kann, und das für mindestens 18 Jahre lang. Da ist es legitim zu fragen, warum das bei Frauen nicht so sein sollte, wo die Einschränkung doch über einen viel kürzeren, überschaubareren Zeitraum vorherrscht.
Ein Pro-Choice-Befürworter würde Ihnen jetzt entgegnen: Neun Monate Schwangerschaft sind nicht risikolos und ein harter Einschnitt, was geht es die Gesellschaft an, darüber zu befinden?
Das will ja auch niemand leugnen. Es geht hier aber nicht ausschließlich um die Schwangere, sondern auch um das Leben eines anderen Menschen. Und da sagt die Gesellschaft, dass der Mensch eine Würde hat, und dass es uns alle etwas angeht. Wenn ich sage, ich bin dafür, dass jedem Kind das Recht auf Leben gewährt wird, heißt das außerdem nicht, dass ich von jeder Frau verlange, dass sie dieses Kind selbst aufzieht.
„Ich glaube, dass jeder Mensch aus gutem Grund so handelt, wie er handelt“
Sie glauben an das Gute im Menschen. Wenn man sich ansieht, wie vehement, ja, menschenfeindlich Abtreibungsbefürworter auf allen Ebenen argumentieren, mit falschen Fotos etwa oder mit Verleumdungen, ja sogar Angriffen, wenn man Berichte von Schwangeren hört, die bei staatlich anerkannten Beratungsstellen quasi nur zum Abholen des für die Abtreibung benötigten Beratungsscheins vorbeigekommen sind, wie können Sie da noch an das Gute im Menschen glauben?
In der Pädagogik nennt man das „Pädagogik des guten Grundes“. Ich glaube, dass jeder Mensch aus gutem Grund so handelt, wie er handelt, und ich glaube an die guten Absichten. Ich glaube daran, dass jeder das tut, was er tut, und dafür einsteht, weil er wirklich der Überzeugung ist, dass es das Richtige ist. Diejenigen, die böse Absichten haben, die wissen, dass das, was sie tun, Schäden anrichtet, die gibt es auch, die sind aber in der Minderheit. Ich bin mir sicher, dass auch die Menschen, die auf den Gegendemos beim „Marsch für das Leben“ sich die Kehle aus dem Hals schreien, dies tun, weil sie ihre Überzeugung für wahr und richtig halten, auch wenn ihr Blick vielleicht getrübt ist.
Das heißt, ein Großteil der Gesellschaft würde, wenn sein Blick nicht getrübt wäre, er Ihr Buch und Corrigenda läse, pro life sein?
Da wäre ich mir nicht sicher. Denn es kommt auch auf die Prämissen an, also wo man lebt, wie man lebt, wie man groß wurde und so weiter. Deshalb gibt es ja auch Argumente wie „Es ist besser, dass das Kind nicht zur Welt kommt, als in einer solch schrecklichen Welt mit so viel Leid“. Aber Leid darf nicht der einzige Maßstab für Moral sein, darüber schrieb ich ein ganzes Kapitel. Ich sage das aus einer sehr privilegierten Position heraus, dessen bin ich mir bewusst.
Wie sähe dann ein Ausweg aus?
Es bräuchte einen kompletten kulturellen Wandel, dass Menschen ihr Leben so lebten, dass eine ungeplante Schwangerschaft keine Katastrophe wäre. Dazu gehört, dass man anerkennt, dass die Würde des Menschen und das Recht auf Leben über allen praktischen Hindernissen steht. Denn natürlich kann man die Gründe für Abtreibung oft sehr gut nachvollziehen, und es wird wahrscheinlich auch immer Frauen geben, die ungewollt schwanger sind, egal wie ideal die Umstände sind. Deswegen ist es oft so ein Struggel, ob wir die Ethik höher halten oder die Praktikabilität. Für viele Menschen ist die Ethik aber nicht so wichtig wie eine lebenspraktische Umsetzung. Deswegen weiß ich nicht, ob wir an diesen Punkt je kommen werden.
„Ich möchte nicht einfach nur Gesetze durchdrücken, die dann keiner mittragen kann“
Bleibt als Alternative ein Abtreibungsverbot. Sie zitieren in Ihrem Buch Studien, die belegen, dass es zu weniger Abtreibungen und auch Schwangerschaften kommt, wenn restriktive Abtreibungsgesetze eingeführt werden. Was halten Sie von einem Abtreibungsverbot?
Es ist folgerichtig. Wenn man der Ansicht ist, dass das Leben bedingungslos schützenswert ist, dann ist das die einzige logische Konsequenz. Doch die Frage ist, erstens, wie genau man es ausgestaltet, und zweitens, wie man das umsetzten will ohne diesen kulturellen Wandel. Ich möchte nicht einfach nur Gesetze durchdrücken, die dann nachher keiner mittragen kann, weil es überhaupt kein Verständnis dafür gibt. Es bräuchte einen langsamen, aber stetigen Wandel.
Sie sind Psychologin und Traumapädagogin. Welche psychischen Folgen können Abtreibungen haben?
Die Studienlage dazu ist schwierig. Es wird von beiden Seiten immer so dargestellt, als wäre das ganz klar, aber man findet, egal, was man beweisen will, die passenden Studien, die das belegen, was man sagen möchte. Es gibt jedoch bestimmte Faktoren, die das Risiko erhöhen, dass eine Frau nach einer Abtreibung zum Beispiel Depression oder Angststörungen entwickelt, oder gar Suizidalität.
Das könnte bei der chemischen Abtreibung, die zuletzt auch wegen der Corona-Maßnahmen zugenommen hat, vermehrt in den Fokus rücken. Die dafür benötigten Medikamente kann man sich in manchen Ländern – und illegal auch in Deutschland – einfach so nach Hause schicken lassen. Wie gefährlich ist das?
Es ist ja schon paradox: Auf der einen Seite wird impliziert, dass illegale Abtreibungen automatisch unsicher seien und Legalität deshalb unerlässlich sei. Auf der anderen Seite verbreiten Organisationen wie „Women on Web“ Abtreibungspillen, um Frauen in Regionen mit restriktiver Gesetzgebung zu „helfen“ und behaupten, das sei sicher. Dabei können bei mangelnder Anamnese oder einer zu weit fortgeschrittenen Schwangerschaft ernsthafte Komplikationen auftreten. Wem es tatsächlich um das Wohlergehen von Frauen geht, dem sollte das sehr bewusst sein.
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Sie sind Katholikin. Doch den Glauben behandeln Sie in Ihrem Buch nur am Rande. Sie warnen sogar davor, religiös-moralisch zu argumentieren. Sätze wie „Wer abtreibt, ist ein Mörder“ sollte man vermeiden. Papst Franziskus hat Abtreibung mehrfach als Mord gegeißelt. Wieso argumentieren Sie nicht auch damit?
Das wird mir immer wieder vorgehalten, dass ich doch Katholik sei und deshalb gar nicht unabhängig von meinem Glauben argumentieren könne. Das ist ein klassisches Ad-hominem-Argument, aber ich steh’ drüber. Meine Pro-Life-Argumente sind aber nicht auf der Prämisse des Glaubens gegründet. Der Untertitel meines Buches lautet: „Wie wir konstruktiv über Abtreibung sprechen können“. Wenn wir also mit Menschen ins Gespräch gehen und auf einen gemeinsamen Nenner kommen wollen, dann müssen wir Prämissen wählen, auf die sich alle berufen können. Außerdem: Es ist ein Unterschied, ob ich etwas in meiner Funktion als Papst sage oder als Apologetin, als die ich mich sehe. Wenn ich als Papst spreche, spreche ich als Autorität, dann habe ich auch die Autorität, in das Leben vieler Menschen hineinzusprechen und einen moralischen Kompass aufzuzeigen. Meine Aufgabe ist es, andere Menschen sprachfähig zu machen, über das Thema Abtreibung und alles, was dazugehört, aufzuklären. Das hat mit dem Glauben an sich erst mal nichts zu tun.
„Wir würden uns selbst ins Abseits schießen, wenn wir nur die sachliche Ebene bedienen würden“
Wie kann man die Menschen erreichen?
Wenn man Menschen wirklich berühren will, wenn man Herzen nachhaltig verändern will, wenn man Menschen zum Nachdenken bringen will, dann muss man sich mit ihnen auf einer Ebene unterhalten, auf der sie mitgehen können, auf der man sie abholen kann.
In Ihrem Buch zeigen Sie viele Argumente fernab der Moral auf. Eines davon ist die Menschenwürde. Doch wird nicht gerade mit der Menschenwürde oft Menschenunwürdiges gerechtfertigt? Beim assistierten Suizid beispielsweise argumentieren humanistische Organisationen mit der Menschenwürde.
Das ist immer eine Frage der Definition und der Deutungshoheit. Wer hat die Macht zu definieren? Das ist auch eine Erkenntnis der vergangenen Jahre, darauf läuft vieles hinaus.
Sollte man in der Diskussion grundlegend ethisch argumentieren oder auch emotionalisieren?
Ich finde es sehr wichtig, die sachlich-ethische Ebene in den Vordergrund zu stellen. Im Gesamtkontext muss es aber auch erlaubt sein, die Gefühlsebene anzusprechen. Es wäre sonst auch ein unfairer Kampf, wir würden uns selbst ins Abseits schießen, wenn wir nur die sachliche und nicht die emotionale Ebene bedienen würden. Ich habe deshalb viel drüber nachgedacht, zum Beispiel über die Verwendung von Fotos von abgetriebenen Kindern. In der Lebensschutzszene ist das sehr kontrovers, da es negative Assoziationen herrufen könne. Aber es ist halt etwas, das funktioniert.
Wenn man Fotos zerstückelter, abgesaugter menschlicher Föten sieht, möchte man mit dem Thema am liebsten nichts mehr zu tun haben.
Ich kann das verstehen, und gleichzeitig war es für mich wie ein augenöffnender Moment, als ich in meiner bisherigen Instagram-Karriere zweimal solche Bilder benutzt habe. Ich habe keine hohen Klickzahlen, aber diese Beiträge gingen fast viral. Denn es animiert Befürworter wie Gegner zu Reaktionen. Und jeder gute Medienschaffende weiß: Auch negative Aufmerksamkeit ist positive Aufmerksamkeit. Es ist also die Frage, in welchem Kontext man solche Fotos benutzt. Ich bin noch nicht zu einem vollständig abgeschlossenen Ergebnis gekommen, aber die Gegenseite arbeitet ja fast nur über die emotionale Schiene, selbst in der Berichterstattung, wieso sollten wir das nicht tun?
Emotional wird es garantiert, wenn Abtreibungsbefürworter den seltenen Fall von Schwangerschaften nach Vergewaltigungen in die Diskussion einbringen.
Ja, das stimmt. Aber dann kann man trotzdem sachlich entgegnen, warum auch in den schlimmsten Fällen eine Abtreibung unethisch ist. Ich bringe an dieser Stelle folgendes Beispiel: Stell dir vor, Deutschland würde es so regeln, dass Frauen, die vergewaltigt wurden, entscheiden dürften, ob ihr Peiniger mit dem Tod bestraft werden sollte oder nicht. Wie würden wir als Gesellschaft dann darüber denken? Wenn man sagt: Ja, klar, finde ich gut, dann öffnen wir Tür und Tor für Selbstjustiz. Oder wir sagen: Nein, das geht nicht, weil auch in solchen Fällen der Rechtsstaat gilt und sie in die Hände eines Gerichts gehören. Wir sind über die Jahrhunderte zu dem Konsens gekommen, dass die zweite Variante die bessere ist. Und an dieser Stelle frage ich dann: Wenn wir uns also einig sind, dass eine vergewaltigte Frau nicht über Leben und Sterben ihres Peinigers entscheiden dürfen soll, wieso sollte das dann für das unschuldige Kind in ihrem Leib anders sein?
„Ich mache Menschen Mut, auch auf die Straße zu gehen“
Sie haben zwei Kinder, mit dem dritten sind Sie gerade schwanger. Stimmen Sie der weitverbreiteten Meinung zu, Deutschland sei kinderfeindlich?
Zu einem gewissen Grad schon. Vielleicht ist es zu viel, wenn man sagt, Deutschland sei kinderfeindlich, aber auf jeden Fall ist es nicht kinderfreundlich. Die ganze Mentalität ist nicht kinderfreundlich.
Was meinen Sie damit?
Kinder werden oft als Störfaktor gesehen in öffentlichen Orten, selbst in der Kirche. Erst vor kurzem war ich in einer Messe, eher konservatives Milieu, aber trotzdem glaubten dort anscheinend viele, alle Kinder müssten während der Messe still dasitzen. In Deutschland wird über Kinder mitunter so gesprochen, wie man es sich über erwachsene Menschen nicht trauen würde. Es ist ganz normal, wenn man sagt „Ich mag keine Kinder, ich kann mit Kindern nichts anfangen“ oder „Kinder sind nervig, Kinder sind zu laut“. Über andere Menschengruppen würde man so nicht sprechen.
Und strukturell? Sind die Strukturen kinderunfreundlich?
Das ist wohl ein bisschen eine Frage der Definition. Aber auch hier gehe ich vielleicht nicht mit dem konform, was viele konservative Menschen für eine ideale Familie halten. Denn dieses eine Bild der Familie gibt es nicht. Kinderbetreuung ja oder nein, geht die Mutter arbeiten, wie gestalten die Eltern das Berufs- und Familienleben? All diese Fragen sollen frei beantwortet werden können. Klar ist aber auch: Müttern soll es ermöglicht werden, viel Zeit zu Hause mit den Kindern zu verbringen, wenn sie das wollen.
Zur Person Sabina Scherer
Sabina Scherer ist 1990 in Baden-Württemberg geboren. Sie studierte Psychologie in Freiburg i. Br. und Salzburg. Während ihrer Elternzeit startete sie den Podcast „Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung“. 2024 erschien ihr Debutbuch „Mehr als ein Zellhaufen“ bei SCM Hänssler. Die Katholikin lebt zusammen mit ihrem Ehemann und bald drei Kindern in Oberbayern.
Wirtschaftlich müssen wir so organisiert sein, dass Familien auch von einem Gehalt leben können. Wie das dann nachher konkret ausgestaltet wird, würde ich auf jeden Fall jeder Familie selbst überlassen. Heute ist es jedoch so, dass sich viele Frauen dazu gedrängt oder genötigt sehen, nach einer Schwangerschaft wieder früh arbeiten zu gehen.
Wer sich für das Lebensrecht ungeborener Kinder einsetzt, wird inzwischen sogar von manchen als rechtsradikal beschimpft. Das Thema ist kein Gewinnerthema. Wie motivieren Sie Menschen zum Mitmachen?
Es ist schwierig, eine pauschale Aussage zu treffen. Man sollte einfach anfangen, darüber zu sprechen. Als ich damals ein Praktikum bei Profemina absolviert hatte, haben mich andere danach gefragt, und ich habe ihnen davon erzählt. Es muss nicht immer gleich eine vorbereitete Rede sein. Wenn man mit irgendeinem Aufhänger damit anfängt, merkt man schnell, dass andere Menschen auch darüber reden möchten.
Reden ist das eine, Tun das andere.
Ich mache Menschen Mut, auch auf die Straße zu gehen, indem ich ihnen beispielsweise ein entgegengesetztes Bild zeichne zu den Stereotypen, die online kursieren, indem ich kontroverse Äußerungen tätige, wodurch vielleicht manche in der Szene sich getriggert, aber andere, neue Menschen sich angesprochen fühlen und sagen: Hey, das finde ich cool! Jede Bewegung braucht Menschen, die auch die eigene Bubble kritisieren. Ich versuche dadurch einen Raum für Menschen zu schaffen, die sich noch nicht so gut darin verorten können. Ich möchte ihnen sagen: Du passt zu uns, auch wenn du nicht in allen Punkten mit uns einer Meinung bist. Ich versuche, den Konformitätsdruck zu reduzieren. Außerdem habe ich keine Berührungsängste. Ich spreche mit Menschen aller Seiten. Ich gebe Ihnen dieses Interview, aber ich bin genauso in Diskussionskreisen, in denen sonst nur lauter Linke und Pro-Choice-Befürworter sind. Aber genau deswegen werde ich auch eingeladen, weil ich anders bin. Meine Message ist: Es ist nicht schlimm, wenn wir auch mal nur in Teilaspekten eine Meinung vertreten.
„Man muss auch lernen, mit Menschen zu diskutieren, die anderer Meinung sind“
Tendieren nicht gerade Frauen oft dazu, der sozialen Erwünschtheit zu entsprechen und eher das zu sagen, von dem sie glauben, die gesellschaftliche Mehrheit verlange es so? Gibt es etwas, das Sie besonders Frauen raten?
Frauen haben es viel leichter als Männer. Das Argument „no uterus, no opinion“ greift bei ihnen schon mal nicht. Ich ermutige aber ausdrücklich alle Menschen, unabhängig irgendwelcher demografischer Merkmale, sich einzubringen, sich zu engagieren. Ich möchte noch ein paar allgemeine Punkte in Diskussionen aufzeigen.
Schießen Sie los.
Man muss auch lernen, mit Menschen zu diskutieren, die anderer Meinung sind. Man kann auch mal bestimmte Diskussionspunkte beiseitelassen und einzelne Fragen diskutieren: Was können wir für Frauen tun, die ungewollt schwanger sind? Wie können wir denn konkret helfen? Oder was sagst du zum Thema Beratungspflicht? Es gibt Menschen, die fühlen sich dazu gezwungen, immer erst mal die Basics zu erläutern und zu verargumentieren, bevor sie zu anderen Punkten übergehen können. Ich finde, es erfordert vielleicht auch eine gewisse Fähigkeit, sich zurückzuhalten und Dinge losgelöst von anderen Themen, gewissen Aspekten oder Prämissen zu diskutieren. Das ist eine Fähigkeit, die ich auch vermitteln möchte.
Also nicht mit der ganzen Tür ins Haus fallen.
Man muss versuchen, einen common ground zu finden, das ist schon mal was, wenn man am Ende sagen kann: Hey, okay, hier haben wir eine Gemeinsamkeit. Zum Beispiel beim Thema Pränataldiagnostik: Der stehen auch viele aus der Pro-Choice-Bewegung kritisch gegenüber, die sagen, ja, das ist wirklich strukturelle Diskriminierung, dass es andere Regeln gibt für Kinder, die Krankheiten oder Behinderungen haben. Die Lösungen mögen dann erst mal unterschiedlich sein, aber dass das grundsätzlich ein Problem ist, da sind wir uns einig. Also könnte man dann weiter fragen und ergründen, welche gemeinsamen Lösungsansätze wir haben. Auch das Pro-Life-Lager braucht Ambiguitätstoleranz: Man muss auch Dinge aushalten können, die sich nicht so gut anfühlen.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?
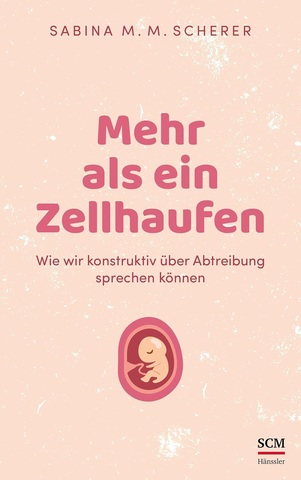





Kommentare
Ich wünschte, es gäbe mehr solch argumentativ starker Frauen, die den Pro-Choice-Schreiern ruhig entgegentreten könnten.