„Die Wahrheit nur wird an die Herzen dringen“

Im Hotel „Maison Messmer“ in Baden-Baden, das Reinhold Schneiders Eltern führten, residierten der deutsche Kaiser Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Auguste Viktoria während ihrer Aufenthalte in dem weltberühmten Kurort, ebenso wie bereits dessen Großvater Wilhelm I. zu jener Zeit, als Reinholds Großvater die Geschäfte führte. Bismarck logierte dort, Großherzöge, Fürsten, Adelige. Hier wurde Reinhold Schneider am 13. Mai 1903 geboren. Der Sohn der berühmten Hoteliersdynastie Messmer erlebte dann als Kind den schleichenden Niedergang der wilhelminischen Pracht. Der Erste Weltkrieg wütete, die Monarchie zerfiel.
Der Vater verkaufte das Hotel nach dem Kriegsende. Die Familie verlor ihr Vermögen in der Inflation, die Ehe der Eltern zerbrach, und Reinholds Vater beging 1922 Suizid. Wenig später unternahm der Sohn auch einen Selbstmordversuch. Der junge kaufmännische Angestellte blieb sein Leben lang zur Schwermut disponiert, doch er distanzierte sich von Absichten der Selbsttötung. 25 Jahre später, 1947 also, publizierte Schneider eine philosophisch-literarisch-theologische Abhandlung „Über den Selbstmord“:
„Hier auf Erden, im Diesseits des Gebets, muss eine Kraft sich entgegensetzen dem Zug zum Tode, der Versuchung zu sterben. Es ist die Kraft des Geistes, der entschlossen ist, das Sein zu denken statt des Nichts, und die Kraft der Liebe, die zum höchsten Menschenbild sich wendet und von ihm über die Menschheit, vom Nächsten zum Nächsten, sich verteilt. Sie wäre unsäglich arm und völlig ungenügend, wenn ihr eine Kraft nicht entgegenkäme: Gottes Macht, der uns das Leben überantwortet hat, auf dass wir es verwalten im Wirken und Leiden und im Tode noch. Er führt uns, wohin wir nicht gewollt, als wir uns noch selber gürteten: Gerade das ist die Verheißung des uns auferlegten Todes, die mit einem jeden Sterben gewonnen, bestätigt werden will für alle. Der Selbstmord ist das sichere Zeichen der Verwirrung aller Ordnungen, die Sünde, die Empörung selbst.“
Der Tod sei, so schrieb Schneider, Franz von Assisis Wort aufnehmend, wie ein Bruder, der eines Tages eingelassen und brüderlich empfangen werden darf, aber der Tod dürfe nicht von eigener Hand herbeigeführt werden. So sei, notierte wiederum Werner Bergengruen, der Tod mitnichten „Vernichter, sondern Vollender, Wandlung ins Unvergängliche“: „Er ist der letzte Ruf Christi an uns, seiner Liebesmacht, die alles an sich ziehen will. Wie dürften wir gehen, ehe wir den Ruf vernehmen?“ Der Christ bleibt also zu Lebzeiten berufen, im „Diesseits des Gebets“ auszuhalten und in der Welt zu bestehen.
Wenn „Menschenhochmut auf dem Markte feiert“
Reinhold Schneider gab 1928 seinen Brotberuf in Dresden auf und vertiefte sein schriftstellerisches Tun: Prosa, Gedichte und Betrachtungen zur Geschichte. Die Sehnsucht nach Hoheit und Würde, auch die Idealisierung der Monarchie ist seinem reichhaltigen, vielgestaltigen Werk zu eigen. Parlamentarischer Streit, die Straßenkämpfe der Extremisten verstörten ihn. Als Monarchist neigte er zur Verklärung vergangener Zeitalter, doch die Liebe zur Geschichte Europas und ihren Königshäusern machten ihn immun für die Ideologie des völkischen Nationalismus.
Er schrieb über Philipp II., über Elisabeth I. von England. 1933 publizierte Schneider ein Buch über das Haus Hohenzollern, mehrfach besuchte er Wilhelm II. im Exil in Doorn. Der Kontakt zum ehemaligen deutschen Kaiser bestand aufgrund familiärer Verbindungen, denn Wilhelm I. und dessen Gattin Augusta waren die Taufpaten der Mutter und der Patentante des Schriftstellers.
Schneider schwärmte für „Das Inselreich“ namens England. Er veröffentlichte 1938 die Erzählung „Las Casas vor Karl V.“, in der er kaum verhüllt die Ideologie des Herrenmenschentums ebenso kritisierte wie die Judenverfolgung. Ein schützendes geistiges Obdach in zunehmend ungastlichen Zeiten, eine geistliche Heimat fand er ab Mitte der 1930er Jahre mehr und mehr im Glauben der katholischen Kirche. Die heilige Messe war für ihn, so bekannte er einmal nach dem Gottesdienst in Potsdam, „die objektive Wahrheit“, „die Wahrheit in Fleisch und Blut und zugleich göttliche außerweltliche Macht“: „Sie ist für mich die einzige Macht, die ein Leben aus den Angeln heben kann.“
Allein den Betern kann es noch gelingen
Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten
Und diese Welt den richtenden Gewalten
Durch ein geheiligt Leben abzuringen.Denn Täter werden nie den Himmel zwingen.
Was sie vereinen, wird sich wieder spalten,
Was sie erneuern, über Nacht veralten,
Und was sie stiften, Not und Unheil bringen.Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt,
Und Menschenhochmut auf dem Markte feiert,
Indes im Dom die Beter sich verhüllen,
Bis Gott aus unsern Opfern Segen wirkt
Und in den Tiefen, die kein Aug’ entschleiert,
Die trocknen Brunnen sich mit Leben füllen.
Emphatisch, auch pathetisch klingt dieses Gedicht heute, zumindest vordergründig. Deutlich wird Schneiders Hoffnung, dass in der Zeit der Diktatur, in der Zeit des „Menschenhochmuts“, die Beter dem Ungeist der Zeit widerstehen und allein Gott treu bleiben. Weder Politiker noch Staaten sind im Letzten allmächtig und werden es auch nie sein. Die Beter führen auch in trostloser Zeit ein „geheiligt Leben“, im Alltag, auch inmitten von Judenhass, Menschenverachtung, Krieg und Barbarei.
„Die Hölle streifte uns“
Im Januar 1945 schrieb Schneider aus dem Freiburger Lorettokrankenhaus an Werner Bergengruen, mit dem er seit 1936 freundschaftlich verbunden war, dass der „ständige Kriegslärm“ sein Befinden verschlimmert habe, aber dass der „Friede dieses Hauses und seine Gottesdienste bisher immer stärker waren als der Lärm“ (dieses und die folgenden Zitate aus den Briefen und Reden sind entnommen: Werner Bergengruen – Reinhold Schneider. Briefwechsel. Hrsg. von N. Luise Hackelsberger-Bergengruen, Herder, Freiburg im Breisgau 1966).
Schneider bekannte sich auch nach dem Kriegsende zu „Gottes waltendem Gericht“ und verdichtete es in dem Sonett „Die Überlebenden“: „Die Hölle streifte uns.“ Die Welt sei „versehrt“, zudem „das Herz zerrissen“, aber wer vom Abgrund der Finsternis wisse, dürfe auf die Liebe hoffen – auf Gottes Liebe –, die einzig den Hoffenden zu retten vermöge.

Zudem träumte er von Rom und schrieb am 12. Februar 1949 dem dort weilenden Bergengruen: „Mein unendlicher Trost ist der sachte heraufziehende Frühling; die Vögel sind voll Freude, bald werden sie auch ihre schönsten Farben tragen. Ich gehe jeden Tag zur Dreisam, um nach der Wasseramsel zu sehen, und immer in der Hoffnung, einmal den Blitz des Eisvogels zu erblicken, den ich nur einmal im Leben sah. Von Mariä Lichtmess an erleichtert sich ein wenig das Herz, und so suche ich doch zu leben in Hoffnung. Eine unsägliche Freude wäre es für mich, mit Ihnen in Rom an den Stätten zu stehen, die uns beiden am liebsten sind.“
In den ersten Jahren der Bundesrepublik wurden Reinhold Schneiders Bücher vielfach gelesen, seine Äußerungen und Reden fanden weithin Gehör, seine Nachkriegsdramen wurden erfolgreich inszeniert. Vielen galt der Schriftsteller als moralische Autorität, als einer, der sich in der NS-Zeit nicht einmal im Ansatz hatte korrumpieren lassen. Als einer der ersten zollte er den Verschwörern des 20. Juli 1944 als Patrioten Hochachtung, zu einer Zeit, in der die Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg von vielen Deutschen noch als Verräter geschmäht wurde. Den Tyrannenmord hielt Schneider allerdings für nicht erlaubt. Jahrelang korrespondierte der Schriftsteller mit Angehörigen des NS-Widerstandes, darunter mit Emmi Bonhoeffer, der Schwägerin Dietrich Bonhoeffers.
Dass er sich konsequent gegen die deutsche Wiederbewaffnung aussprach, er 1951 friedensethische Beiträge in der Ostzonen-Zeitschrift Aufbau publizierte, machte ihn manchen indes verdächtig. Der pazifistisch gesinnte Katholik Schneider ein gefährlicher Kommunist, ein Unterstützer des SED-Regimes? In Bundespräsident Theodor Heuss hatte er einen Fürsprecher, der die Wogen um ihn glättete.
1956 wurde Schneider der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. In der Festrede (Tondokument hier) gab er gleichsam Aufschluss über sein Selbstverständnis als Schriftsteller: „Als solcher kann, möchte er nur, aus der ganzen Kraft seines Herzens ein Zeichen sein, und zwar der Liebe: gegen alle Wahrscheinlichkeit muss an der Stelle, wo wir angelangt sind, eine Hoffnung sich erheben, ein Bemühen entfacht werden, die den heute gedachten, vollzogenen Gedanken des Todes entgegen sind. Alle Katastrophen der Geschichte haben sich im Geistigen und Sittlichen ereignet, ehe sie sich in materiellen Machtkämpfen dargestellt haben. Sie sind also angewiesen auf ein bestimmtes Klima des Denkens, Glaubens, Wünschens; wo sie dieses nicht spüren, brechen sie nicht vor.“
Das zerschlagene Kreuz, eine Schlüsselszene
Schneider klammerte sich an die Hoffnung, die dem Christen verheißen ist. In der essayistischen Betrachtung „Die Schächer ohne den Herrn“ beschrieb er 1954 den Aufruhr in Flandern von 1566, einer Zeit, in der alte Kirchen geplündert und geschändet wurden von „aufgewühlten Volksmassen“. In einer Kirche vergriffen sich die Bilderstürmer an einer Kreuzigungsgruppe. Sie zerschlugen das Bild, stürzten also das mittlere Kreuz um und ließen die Kreuze der mit Jesus zusammen gekreuzigten Verbrecher stehen, „in denen sie Abbilder ihres eigenen Wesens sehen mochten“.
Reinhold Schneider fasste es so: „So entstand dieses Sinnbild, das der Menschengeist nicht hätte ersinnen können: die Schächer ohne den Herrn. Eine furchtbare Lücke klaffte zwischen den beiden Kreuzen; nun war auch der Reumütige verloren, dem der Herr das Paradies verheißen hatte; denn der Herr, der ihn bis dahin führen wollte, war ihm entrissen. Und in welcher Verlorenheit stand das Kreuz des Lästerers! Der Mittler war verschwunden, die Mitte war leer; vergebens blickte der eine zur Höhe, kehrte sich der andere verkrampften Leibes zur Erde. (…) Die Kreuze standen in einer grundlosen Nacht, im reinen Nichts.“

Seinen letzten Winter verbrachte Schneider in Wien, nannte das Burgenland seine „heiße Liebe“, schwärmte in einem Brief vom 18. März 1958 an Bergengruen vom Theater, fühlte sich in Österreichs „grenzenloser Schwermut“ zu Hause und dachte zurück an beseligend-melancholische Weingenüsse: „Mir ist der Abschied von Wien schwergefallen; es ging Unermessliches an mir vorüber und mir durch die Seele; ich bin dem nicht mehr gewachsen, aber ich fühle mich ganz verändert und taste mich hier mühsam zurecht! Einer zersplitternden Welt kann ich nur Splitter bringen.“
Plagende Zweifel, schwere Krankheit, plötzlicher Tod
Werner Bergengruen nannte in der Gedenkrede „Zum Tode Reinhold Schneiders“ den Schriftsteller und Freund einen der „wahrhaft bedeutenden Vertreter christlicher Geistigkeit im deutschen Sprach- und Kulturgebiet und vielleicht der universellste und markanteste unter ihnen“. Schneider war in Freiburg, kurz nach seiner Rückkehr aus Wien, auf dem Weg zur mitternächtlichen Feier der Osternacht so schwer gestürzt, dass er nur Stunden später in den frühen Morgenstunden des 6. April 1958 im Lorettokrankenhaus an Gehirnblutungen starb.
Bergengruen würdigte auch später noch Schneiders intellektuelle Redlichkeit und verteidigte ihn gegen jegliche „Querköpfe“, die ihm Glaubenslosigkeit unterstellten oder sogar meinten, „ihn – gerade ihn – gegen die Kirche ausspielen zu können“. Schneider hatte nie verschwiegen, dass er, wie viele Heilige und Apostel, auch nicht von Zweifeln frei gewesen sei, die er getragen und ertragen habe, ebenso wie bedrängende körperliche Leiden, darunter eine schwere Darmerkrankung, bis hin zu der „an die dunkelste Verzweiflung sich steigernden Schwermut“.
Nirgends aber finde sich ein willentlich vollzogener Akt einer „Absage an die Kirche und ihren Glauben“. Die Kirche sei „weiser und feinfühliger“ als alle „grobschlächtigen Gemüter“, sie habe Reinhold Schneider geehrt, als „Vorbeter“ gerühmt und ihm zahlreiche „Ehren erwiesen, die, wie die Aufbahrung und Einsegnung im Freiburger Münster, sonst dem bischöflichen Range vorbehalten sind“. Bergengruens Grabrede auf den toten Freund endete mit den folgenden Versen Schneiders:
„Und über Zweifelsqualen
reißt mich die Liebe fort.“
„Wir können nur bitten“
Luise Hackelsberger-Bergengruen, eine der Töchter Werner Bergengruens, griff in ihrer Würdigung von Reinhold Schneider Worte aus dem Jahr 1953 auf. Er habe den christlichen Dichter, so auch sich selbst, als „Verkünder im Dienste des verborgenen Gottes“ verstanden, dessen poetische Absicht im Werk untergegangen, also aufgehoben sein müsse. Sie benannte Schneiders „innerstes Daseinsgeheimnisses“: „Erst gegen Ende seines Lebens hat er es gelüftet, und wir gewahren bestürzt, wie kostbar das Opfer ist, das er in die Waagschale wirft: Die eigene Existenz, die, eingetaucht in Melancholie, Verlassenheit und Schmerzen, die Dinge unserer Welt geliebt hat.“
Wer sich heute die Schätze und Perlen der christlich inspirierten, gläubigen Dichter – und Reinhold Schneider gehörte fraglos hierzu – lesend, denkend und auch meditierend vergegenwärtigt, der mag erahnen oder auch erkennen, welche Kostbarkeiten heute nur noch wenig Beachtung finden und wie viel Wertschätzung diese Literatur verdiente. In „Verhüllter Tag“ (1954) legte Schneider ein Bekenntnis zu seinem Gott ab:
„Ich hatte von Anfang an das Gefühl, tief ins Dunkel zu gehen. … Wir können nur bitten, dass uns Christus nicht verlässt im Sterben. Aber auch das kann ja geschehen – wie Er verlassen wurde am Ende, die Liebe von der Liebe um der Liebe willen. Wir können nur bitten, dass er uns, nach schrecklicher Überfahrt, erwartet am anderen Ufer – Freund und Feind, uns Alle, Alle.“ (zitiert nach der Ausgabe „Bücher der Neunzehn“, Köln 1956)
Berühren uns heute diese sehr persönlichen, gänzlich ungeschmeidigen Worte Reinhold Schneiders? Nichts Weltliches, nicht das Geringste, spricht für die Aktualität seiner Prosa und seiner Dichtungen. Reinhold Schneiders unzeitgemäße Texte finden sich nach dem Kulturbruch, der durch die 1968er-Bewegung veranlasst wurde, nicht mehr in deutschen Schulbüchern. Vielleicht spricht gerade das dafür, seine Schriften neu, staunend und resonanzvoll zu lesen.
Kennen Sie schon unseren Telegram-Kanal? Und – ganz neu! – unseren WhatsApp-Kanal?

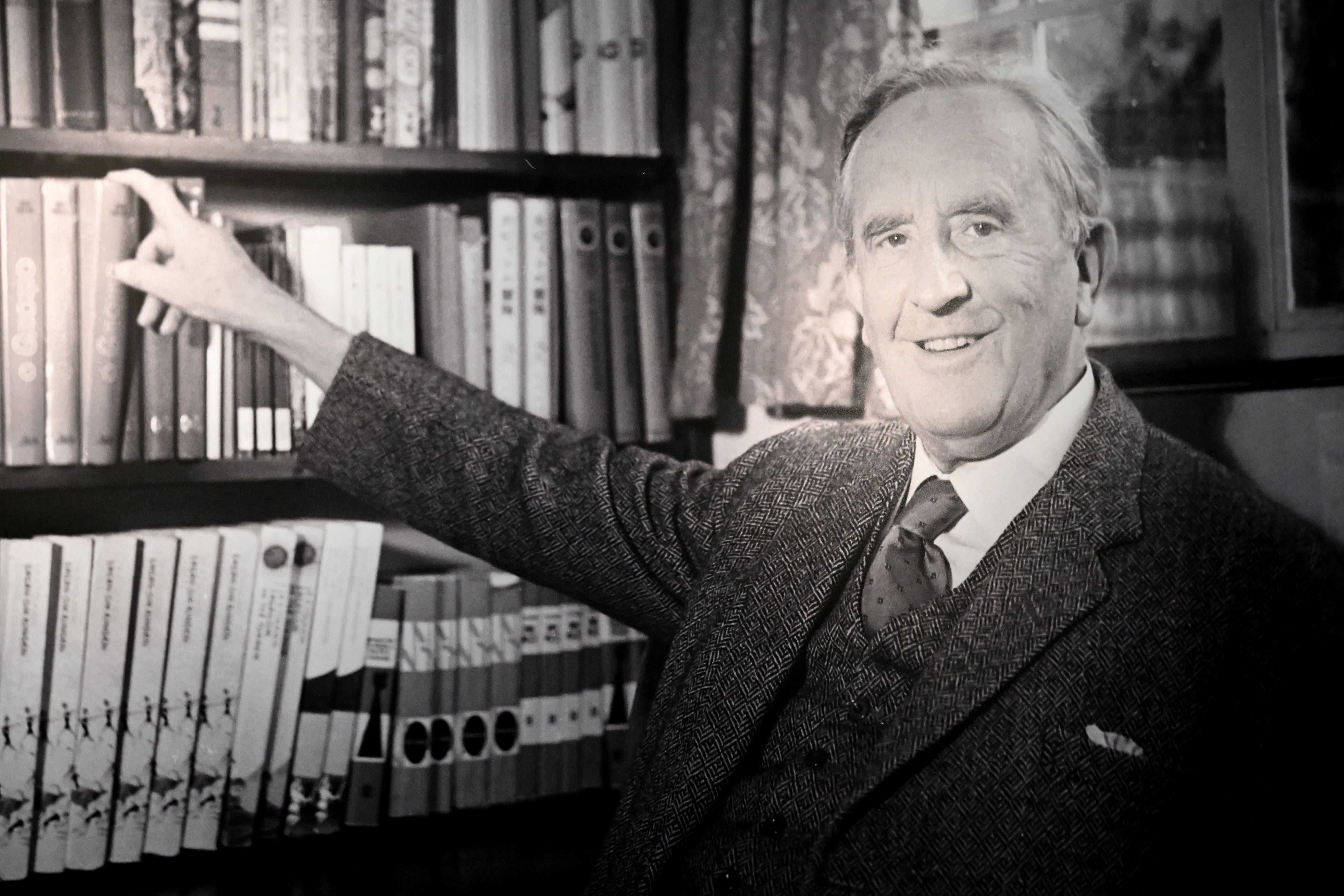



Kommentare