Humus für Hoffnung

Seine große Zeit hatte er in Zeiten eines Weltuntergangs als erfolgreicher Propagandist guter Laune mit hohen Verkaufszahlen. Dennoch endete er als Inhaber eines Waschsalons: Rudi Schuricke, der deutsche Schlagerstar der 1940er Jahre. Während des Zweiten Weltkriegs verbreitete er gute Laune inmitten des absehbaren Untergangs.
Es hatte ja mit der Hybris Adolf Hitlers begonnen, sich mit allen anzulegen. Eigentlich musste jeder wissen, dass das schiefgehen würde, wäre da nicht der massive Propagandamix aus Ideologie, Lügen und Verschweigen gewesen, der die Menschen bei Laune, oder sagen wir besser: bei der Stange gehalten hatte.
Goebbels verordnete gute Laune
Zum Thema „gute Laune“ trug nicht zuletzt auch die Kunst bei, vor allem die leichte Muse. Wie es in totalitären Regimen üblich ist, überließ man nichts dem Zufall und schaltete alle Bereiche des öffentlichen Lebens gleich – auch die Kultur. Die „Gottbegnadeten-Liste“ – sie hieß wirklich so! –, ein beeindruckend langes unter Joseph Goebbels zusammengestelltes Verzeichnis deutscher Künstler, die dem NS-Regime wichtig erschienen und daher von diesem unter besonderen Schutz gestellt und in der Regel auch vom Kriegsdienst freigestellt wurden, führt neben den Kino- und Theatergrößen aus dem U- und E-Bereich wie Heinz Rühmann und Bernhard Minetti auch Rudi Schuricke (1913-1973) auf. Er war als Schlagersänger den Propagandisten nützlich ob seiner Gute-Laune-Ausstrahlung.
1940, als die Wehrmacht bereits vor dem Eiffelturm stand und damit ein weiterer erster Übergriff auf einen europäischen Nachbarn vollbracht war, von dem man wissen musste, dass so etwas nicht gut enden würde, sang Rudi Schuricke mit dem Orchester Kurt Widmann:
„Optimismus ist die beste Medizin,
Alle Schmerzen, alle Sorgen, schnell entfliehen,
Wenn du lustig bist und total vergisst,
Was vielleicht nun einmal nicht zu ändern ist.“
In der aufsteigenden Phase einer gigantischen inneren und äußeren Weltunterjochung, von der man zu diesem Zeitpunkt möglicherweise ahnte, dass sie sich am Ende nicht bewerkstelligen lassen würde, von der man aber dennoch gelernt hatte, dass sie unvermeidbar war, rät Rudi Schuricke dazu, optimistisch zu sein und bedient damit eine Strategie, die typisch ist für Regisseure auswegloser Situationen. Der Schlagersänger als kultureller Funktionshäftling des Systems rät zur Ablenkung als Hilfe. Wenn etwas nicht zu ändern ist, zumal etwas Bedrohliches, dann lasst uns wenigstens lustig sein!
Optimistisch auf dem Vulkan tanzen …
Wobei – wohlgemerkt – damit nicht der Humor gemeint ist, der gerade in schlechten Zeiten ein probates Mittel zur Depressionsprävention ist. Der 40er-Jahre-Schlager empfiehlt den Optimismus als voluntaristische Methode zur Ablenkung vom Eigentlichen. Der Humor hat hingegen, anders als der Optimismus, der das Bedrohliche ignoriert, die Fähigkeit, das Bedrohliche dadurch zu relativieren, dass er es gerade nicht verdrängt, sondern ihm beherzt ins Gesicht lacht.
Humor, sagt Chesterton, ist die Wahrnehmung des Unpassenden einer besonderen Art. Wenn das Unpassende den Bereich des Harmlosen verlassen hat, dann wird der Humor zwar unter Umständen schwarz, aber er bleibt an der Sache, ohne ihr auszuweichen. Er blickt bewusst auf das Unvermeidliche, Unschöne, Böse oder auch nur Komische, um über es hinauszuschauen auf das, was durchaus vermeidbar, schön, gut und ernsthaft ist. Das Wertvolle wird auf diese Weise durch den Humor vor der Vergessenheit gerettet, selbst dann, wenn es zerbrochen vor einem liegt.
Humor ist deswegen „hintergründig“. Er leuchtet über das hinweg, was stört, und trifft den Kern dessen, was heil ist. Humor ist deswegen weitaus mehr Medizin, als es der Optimismus ist, der in seiner streng ignoranten Kosmetik an allem vorbeischaut, um sich die Laune nicht zu verderben. Optimismus ist grundlos. Er schwebt ohne eine Bindung an Wahrheiten im Raum und spielt seine Ohnmacht in einer Haltung aus, die mit verschlossenen Augen auf dem Vulkan tanzt.
Rudi Schurickes „Capri-Fischer“
Als Rudi Schuricke 1943, nachdem der Sinkflug des Nazikrieges schon eingesetzt hatte, in einem weiteren Schlager die rote Sonne bei Capri im Meer versinken ließ, wurde der italoromantische Schmachtfetzen bald wieder aus dem Verkehr gezogen, weil Italien nach dem Sturz Mussolinis das Bündnis mit Deutschland aufgekündigt hatte und fortan nicht mehr „zu den Guten“ zählte. Erst 1946, im Wiederaufbau, war die urdeutsche Italiensehnsucht erneut erlaubt und das Lied schnell entnazifiziert.
So wie auch Rudi Schuricke, der mit dem Song einen seiner größten Erfolge feiern konnte. So wurde aus der beliebten seichten Ablenkungsmusik aus der Höhe der Kriegszeit ein nicht minder beliebter Nachkriegserfolg. Die Sonne durfte wieder strahlen und anschließend unbedenklich im Meer versinken. Denn alle Zweifel daran, dass sie am nächsten Morgen wieder aufgehen würde, waren erst einmal verjagt.
Das erneuerte Bedürfnis nach Italien und seinen bella Maries löste nach Kriegsende den ramponierten Optimismus ab und umflorte die Aussicht auf wirtschaftliche Erholung mit dem schmalzig-mediterranen dolce vita als Hilfe zum kollektiven Vergessen.
So gebiert der Optimismus als Gegenwartverdrängung stets auch das Verdrängen der Vergangenheit. Denn man will die Wahrheit nicht sehen, nicht jetzt und nicht morgen und auch nicht die von gestern.
… Pessimistische Untergangsszenarien
Beobachtet man den gegenwärtigen Weltbrand, findet man die Feststellung, dass der Optimismus ein wenig taugliches Mittel ist, um Krisen zu bewältigen, auf eine geradezu paradoxe Weise bestätigt. Denn der Optimismus, das ansonsten so beliebte Pflaster zur Bedeckung der schwärenden Wunden von Angst und Aussichtslosigkeit, hat offensichtlich ausgedient und wird derzeit vom Pessimismus abgelöst.
Der Journalist und Orwell-Spezialist Dorian Lynskey, den die Tageszeitung Welt mit dem Titel „Weltuntergangsforscher“ bedenkt, stellt in seinem aktuellen Buch „Everything Must Go. The Stories We Tell About the End of the World“ fest, dass die Menschheit gegenwärtig keine Lust auf Optimismus hat, sondern eher gefesselt ist von den drohenden Szenarien eines allgemeinen Endes.
Es hat sich wohl herumgesprochen, dass ein optimistisches Wegschauen kaum mehr möglich ist. Stattdessen versetzt das Starren auf die Prognosen eines Atomkrieges und das theatralische Inszenieren von Untergangsszenarien viele geradezu in einen Rausch, der sie paralysiert und ihnen den Schmerz darüber, dass nach dem möglichen Untergang eben ein Ende und kein neuer Anfang steht, betäubt.
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Nicht nur das Spiel mit der nuklearen Vernichtung, sondern auch das bereits in der Kita propagierte Ende des Planeten durch das Spiel mit dem ungezügelten Fleischkonsum gilt als verloren, wie es nur verloren sein kann. Denn es gibt nach der uns ständig vor Augen gehaltenen auf uns zukommenden Apokalypse aus der pessimistischen Perspektive keinen neuen Himmel und keine neue Erde, wie es das Neue Testament prognostiziert. Und es zeigt sich, dass nach der wenig aussichtsreichen Haltung der Optimisten, die das Verdrängen befeuert, nun der Pessimismus flächendeckend um sich greift, der in seiner Aussichtslosigkeit entweder allgemeine Depression oder suizidales Verlangen zur Folge hat.
Wer christlich hofft, weiß sich getragen vom HERRN der Zeiten
Ich behaupte nun, dass beide – Optimismus und Pessimismus – gleichermaßen an Wirklichkeitsverlust leiden. Denn weder das verdrängende Schönreden noch die defätistische Ohnmachtsergebung sind berechtigt – jedenfalls für denjenigen, der die Haltung eines glaubenden Menschen einnimmt und nicht Opfer unserer agnostischen und mittlerweile auch aggressiv atheistischen Welt geworden ist.
Der gläubige Mensch kennt – wenn er Christ ist – die Tugend der Hoffnung. Sie ist im Gegensatz zum Optimismus kein grundloser Verdrängungsmechanismus und auch keine unbegründete Spekulation auf ein rheinisches „Es ist noch immer gut gegangen“, sondern eine begründete Haltung des Vertrauens auf das, was als dem Menschen entzogene und deswegen auch nicht von ihm machbare Wirklichkeit unzerstörbar ist.
> Lesen Sie auch: Jenseitsfürsorge
Wer christlich hofft, weiß sich getragen von einem nicht selbst konstruierten, sondern immer schon realen Gott, der Gegenwart und Zukunft in Seiner Hand hält und in Jesus Christus höchstpersönlich in die arg gebeutelte Welt eingetreten ist, um allen Weg und Ausweg zu sein, die Ihm vertrauen.
Hoffnung, christlich gewendet, hat eine andere Nuancierung, als wenn ich sage „Ich hoffe auf schönes Wetter!“ oder „Ich hoffe auf einen guten Ausgang der nächsten Parlamentswahl!“ Denn dort geht es immer nur um das, was ich erwarte und was dann eintritt oder auch nicht und das mich am Ende glücklich oder enttäuscht sein lässt. Auf diese Unsicherheit hin wäre der Optimismus als Überlebensstrategie verständlich.
Hoffnung und Vertrauen sind zwei Seiten einer Medaille
Bei der christlichen Hoffnung geht es zwar auch um das, was ich erfüllt sehen möchte, aber – und das ist ganz entscheidend – die Hoffnung weiß sich über allem Wünschen und Erfüllen von Gott getragen und überlässt Ihm die Erfüllung nach Seinem Willen, von dem man eines mit Sicherheit weiß: dass Gott ihn nie gegen den Menschen richtet, den Er geschaffen hat, weil Er ihn liebt. Und das gilt auch im Fall böser Überraschungen, in die Menschen die Menschen stürzen können.
Hoffnung ist die Kehrseite des Vertrauens, das man haben darf, weil Gott es den Menschen in Seinem Sohn zuerst geschenkt hat, als er alle Krankheiten und selbst den vernichtenden Tod auf Sich nahm, um für sie das Leiden an der Endlichkeit zu besiegen und dem Leben in Seinem Reich das letzte Wort zu geben.
Wer aufgrund dieses Urvertrauens Hoffnung hat, so dass er Gott alles anvertraut – seine Gegenwart und seine Zukunft, sein Versagen und seine Stärken, seine Zeit und das, was sie von ihm verlangt –, muss das mögliche Ende von allem nicht verdrängen, um es zu ertragen, muss es auch nicht im Untergangsfieber herbeizelebrieren, um es hinter sich zu haben. Er kann mit dem Ende leben, weil er weiß, dass das Ende nicht das Ende ist.
„Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen“
Natürlich erheben sich dagegen die üblichen Stimmen der Anklage gegen das Christentum als Opiat zur Betäubung des Weltschmerzes – was im Übrigen kein Wunder ist, setzt die Tugend der Hoffnung doch Glauben voraus, den man nicht als eine Verfügungsmasse der Vernunft verstehen darf, weswegen der Glaube sich gar nicht vor dem Verstand für den Vorwurf der Irrationalität rechtfertigen muss. Insofern läuft der rationalistische und materialistische Angriff gegen den Glauben in Watte, weil der Glaube sich der Versuchung zur verstandesmäßigen Beweisführung grundsätzlich entzieht.
Glaube und Hoffnung sind Haltungen, die geschenkt sind und nicht erworben. Weswegen es so wenig Sinn macht, zwischen Glaube und Vernunft zu streiten wie zwischen Liebe und Vernunft. In jedem Fall wäre es eine für unsere krisengeschüttelten Tage wunderbare Nachricht, wenn die Christen verstärkt mit der Stimme ihrer Hoffnung in die derzeitigen todessehnsüchtigen Untergangsprognosen hineinrufen würden: „Auch wenn Himmel und Erde vergehen – Gott wird nicht vergehen!“ (vgl. Lk 21,33). Die Christen können den Untergang zwar auch nicht verhindern, aber sie wissen, wie man ihn überlebt.
Das gälte es aus meiner Sicht – besonders von kirchenamtlicher Seite – lauter zu sagen, als es derzeit geschieht, wo die Vertreter der christlichen Kirchen eher in das allgemeine Lamento einstimmen, statt es seines Nihilismus zu entkleiden und Hoffnung zu schenken.
Zeit, Hoffnung auf Heil zu pflanzen
Hoffnung ist die weitaus bessere Medizin – nicht nur besser als die, die Rudi Schuricke seinerzeit für möglich hielt, als er in einer kriegerischen Zeit mit seiner Schlagerstimme den Optimismus predigte, sondern auch eine bessere als die Utopie, die der Weltuntergangsforscher Lynskey aus der Mode gekommen sieht.
Denn nach dem fast vollständigen Verlust von Halt und Ziel hat sich ein ohnmachtsanfälliges Verlassenheitsgefühl eingestellt. Erfolglose Optimismuskosmetik geht in suizidale Pessimismusstarre über. So what! Im Grunde doch der passende Humus, wie ihn die Christen schon am Anfang ihrer Geschichte im dekadenten und langsam untergehenden Imperium Romanum vorgefunden haben, um in ihn erfolgreich ihre Hoffnung auf Heil zu pflanzen.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

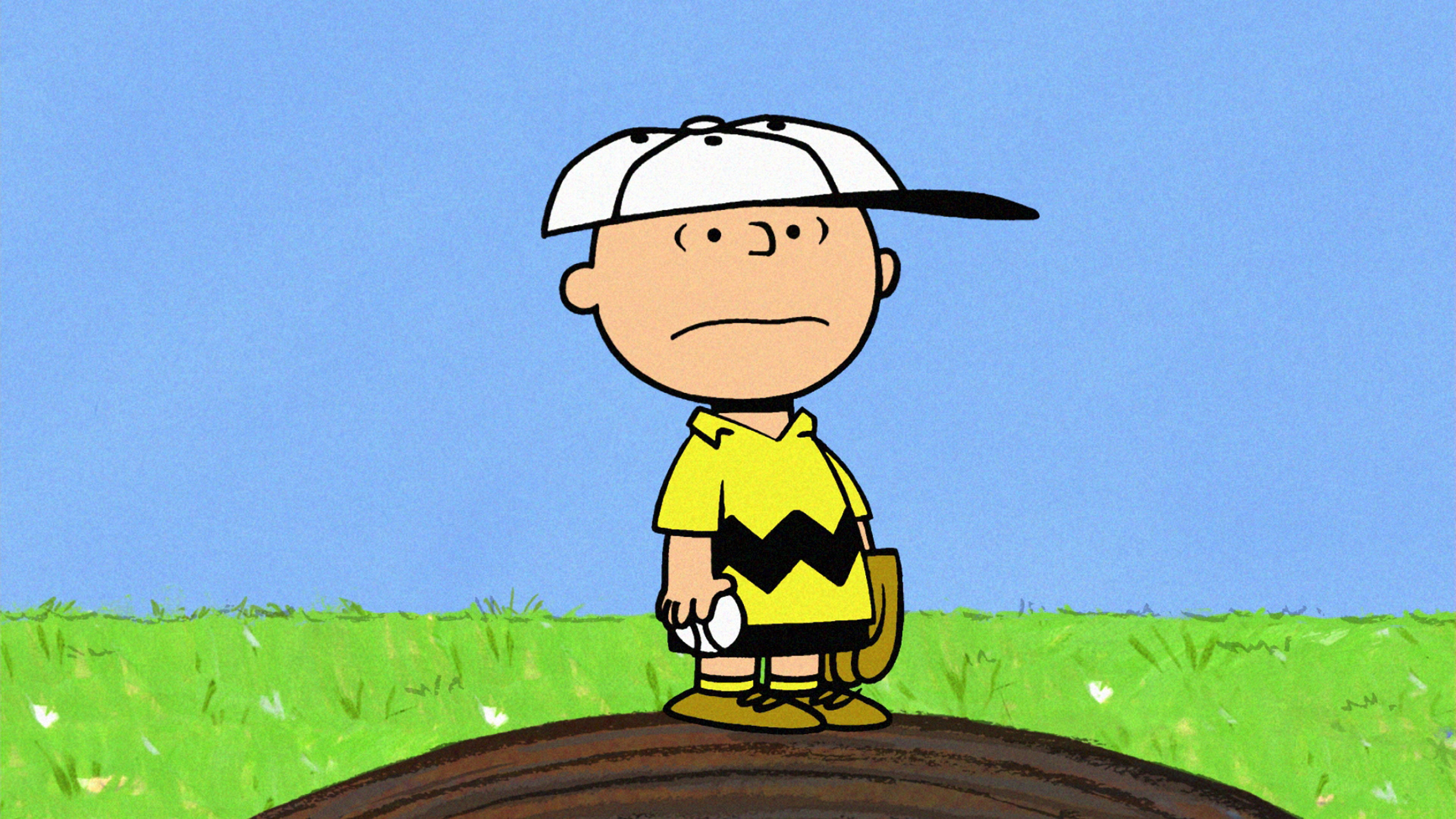



Kommentare
„Auch wenn Himmel und Erde vergehen – Gott wird nicht vergehen!“ (vgl. Lk 21,33). Die Christen können den Untergang zwar auch nicht verhindern, aber sie wissen, wie man ihn überlebt.
Das gälte es aus meiner Sicht – besonders von kirchenamtlicher Seite – lauter zu sagen, als es derzeit geschieht, wo die Vertreter der christlichen Kirchen eher in das allgemeine Lamento einstimmen, statt es seines Nihilismus zu entkleiden und Hoffnung zu schenken.
In der Botschaft stimme ich Ihnen gerne zu.
Der Wunde Punkt ist leider, dass - Sie persönlich möchte ich ausnehmen - innerhalb der 'Kirchen' offensichtlich grundsätzlich nur eine sehr geringe Anzahl unter den 'Hirten' zur Verfügung steht, die zu einer solchen Einsicht überhaupt fähig sind. Ein internes und grundlegendes Glaubens- und Strukturproblem.
Lieber Herr Pfarrer Dr. Rodheudt,
Ihr Bistum Aachen hat zusammen mit Trier die bundesweit niedrigste Kirchenbesucherquote mit 4,5% (im Vergleich zu Primus Görlitz mit 14,4%): https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2025/2025-03-27_Statistik-Bistumstabelle_2024-vorlaeufige_Ergebnisse.pdf.
Da es an Ihnen augenscheinlich nicht liegt: Hat Sie Ihr Bischof schon als "Nachhilfelehrer" angefragt? ;-)