Die Schwerter schmieden

Lukas Steinwandter identifiziert das Grundübel unserer Zeit mit „einer tatsächlich herrschenden Ideologie, die schwer auf einen Begriff zu bringen ist, aber gekennzeichnet ist durch Diesseitigkeit, Materialismus und Gottvergessenheit“ und ruft dazu auf, „die Schwerter für den großen Kampf zu schmieden“; gemeint ist: gegen diese Ideologie. Der vorliegende Diskussionsbeitrag möchte eine Antwort darauf geben, worin diese herrschende Ideologie besteht und welcher Art die zu schmiedenden Schwerter sind.
Steinwandter deutet an, dass das Kirchenoberhaupt dieses Grundübel nicht adressiert habe. Tatsächlich ist dem nicht so. Gerade in der in konservativen und (wirtschafts)liberalen (Kirchen)Kreisen oftmals als „grün“ verschrienen Enzyklika „Laudato Si’“ benennt Papst Franziskus diese Ideologie eindeutig als das in der heutigen Zeit vorherrschende „technokratische Paradigma“, nach dem sämtliche Probleme und Fragestellungen rein technisch lösbar seien. Mit anderen Worten: Sie handeln sich im Letzten nicht um eine Frage der Wahrheit, sondern allein der Macht.
Hier findet sich die Vorstellung der Selbsterlösung, von der Steinwandter spricht und die sie tatsächlich alle eint: progressive Klima-Ideologen mit der Illusion von Green Growth und den Verheißungen eines „Green New Deal“, linke Transgender-Gläubige, die den menschlichen Leib und mit ihm unsere Sexualität auf eine technisch nach Belieben manipulierbare Biomasse reduzieren und, last but not least, liberal-konservative Technikgläubige.
Technik und Macht stellen keine Probleme per se dar
Geistesgeschichtlich lässt sich das technokratische Paradigma bis zu frühneuzeitlichen Denkern wie Francis Bacon und René Descartes zurückverfolgen und besteht in der Tat an seiner Wurzel ganz wesentlich in der von Steinwandter erwähnten „Ablehnung der klassischen, abendländlichen Metaphysik“ namentlich in ihrer Fassung von Aristoteles. Und an dieser Stelle werden wir noch die zu schmiedenden Schwerter finden.
Auch hierzu hat uns Papst Franziskus in „Laudato Si’“ einen Fingerzeig hinterlassen. Bei der Behandlung des technokratischen Paradigmas zitiert er keinen Autor so häufig wie den katholischen Priester und Religionsphilosophen Romano Guardini. Ganze sechsmal zitiert er aus dessen Werk „Das Ende der Neuzeit“.
In diesem Buch gibt sich der Realist Guardini nicht reaktionären Illusionen über eine Rückkehr zu früheren Zuständen hin. Das technische Zeitalter ist für ihn eine unhintergehbare Gegebenheit. Guardini ist als guter Katholik weder Primitivist noch Anarchist. Technik und Macht stellen für ihn per se keine Probleme dar. Das Problem besteht vielmehr darin, dass, wie ihn auch Franziskus zitiert, „der moderne Mensch nicht zum richtigen Gebrauch der Macht erzogen wird“. Der technische und ökonomische Fortschritt des Menschen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der ethische und spirituelle Fortschritt nicht Schritt mit ihm gehalten haben.

Die vier Schwerter, die es zu schmieden gilt
Diesen Gedanken griff Guardini in seinem später erschienen Buch „Die Macht“ auf, an dessen Ende er fragt, was es denn brauche angesichts dieser Situation. Er nennt vier Punkte:
- Wir müssen wieder eine kontemplative Haltung verwirklichen – der Allgegenwart von Aktion, Organisation und Betrieb ein Innehalten entgegenhalten, um mit dem Wesentlichen und Bleibenden in Kontakt zu kommen. In diesem Sinne spricht auch Papst Franziskus in seinem Schreiben „Querida Amazonia“ von der Prophetie der Kontemplation als einem Heilmittel gegen das technokratische Paradigma. In den Worten Guardinis: der Mensch „muss wieder meditieren und beten“.
- „Wir müssen wieder die elementare Frage nach dem Wesen der Dinge stellen“, also nach ihrer Wahrheit und nicht nur nach der Machbarkeit.
- „Wir müssen wieder lernen, dass die Herrschaft über die Welt die Herrschaft über uns selbst voraussetzt“. Es geht um die Einübung der Tugenden.
- „Wir müssen wieder im Ernst die Frage nach Gott stellen,“ also nach der ultimativen Wahrheit.
Hier haben wir die vier Schwerter, die es zu schmieden gilt, um den in Steinwandters Artikel erwähnten gordischen Knoten durchschlagen zu können: das Einüben einer kontemplativen Haltung, das Frage nach dem Wesen der Dinge und nach Gott sowie die Vermittlung bzw. das Einüben der Tugenden.
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge.
Ein neues Bildungs- und Erziehungsprogramm
Bei näherem Hinschauen zeigt sich, dass sich hinter diesen vier Punkten ein aristotelisches Bildungs- und Erziehungsprogramm verbirgt:
- Für Aristoteles war – nach seiner „Nikomachischen Ethik“ – das kontemplative (bzw. im Griechischen das theoretische) Leben die höchste Form menschlichen Lebens. Freilich hatte das kontemplative Leben für ihn noch nicht die spezifisch religiöse Bedeutung der Christen späterer Tage.
- Die Frage nach dem Wesen der Dinge setzt die – von den frühneuzeitlichen Vätern des technokratischen Paradigmas gerade deshalb abgelehnte – aristotelische Metaphysik voraus, die, wie der US-Philosoph Edward Feser in seiner gegen die „neuen Atheisten“ um Richard Dawkins gerichteten Polemik „Der letzte Aberglaube“ deutlich gemacht hat, vollkommen zu Unrecht als widerlegt und überholt gilt.
- Die bereits erwähnte „Nikomachische Ethik“ schildert die Tugenden als Entfaltungen der inhärenten menschlichen Fähigkeiten des Verstandes und des Willens und damit als den Weg zu Erfüllung und Glück durch praktische Übung, Bildung und Erziehung.
- Wiederum in der „Nikomachischen Ethik“ nannte Aristoteles die Theologie die höchste Wissenschaft unter der Bedingung, dass Gott tatsächlich existiere – eine Bedingung, die er explizit bejahte, wenn auch sein Gottesbegriff natürlich noch nicht die konkrete Bestimmtheit der christlichen Offenbarung besitzen konnte.
Geschenkt der Hinweis, dass dieses Programm in unserem heutigen Bildungs- und Erziehungswesen kaum Verwirklichung findet. Stellt sich also die Frage, wie eine aristotelische Bildungs- und Erziehungsreform ins Werk zu setzen wäre. Der ehemalige Marxist und heutige katholische Moralphilosoph Alisdair MacIntyre hat in „After Virtue“ herausgearbeitet, wie speziell die Tugenden für ihre Herausbildung auf Gemeinschaften angewiesen sind, die durch ein gemeinsames Verständnis des Guten und der Güter charakterisiert sind und dies entsprechend leben.
Auch in feindlicher Umgebung ist Gemeinschaftsbildung möglich
Früher war eine solche Gemeinschaft die Kirche. Heute kann das erwähnte gemeinsames Verständnis des Guten und der Güter selbst für die Kirche nicht länger vorausgesetzt werden, von der Bedeutung der Einübung der Tugenden ganz zu schweigen.
Was sich also konkret als Aufgabe stellt, ist das Initiieren solcher Gemeinschaften. Als Schwierigkeit stellt sich dabei heraus, dass unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ganz darauf ausgerichtet ist, den Einzelnen aus seinen gemeinschaftlichen Bindungen wie Ehe und Familie herauszulösen, ihn zu „emanzipieren“, um ihn seiner systemkonformen Bestimmung als – letztlich austauschbare –Arbeitskraft, Verbraucher sowie Steuer- und Sozialabgabenzahler zuzuführen.
Diese Systemzwänge stellen sich jeder Gemeinschaftsbildung entgegen. Der Blick in die frühe Kirche zeigt, dass auch in feindlicher Umgebung Gemeinschaftsbildung grundsätzlich möglich ist. Allerdings war den Menschen damals das Leben in Gemeinschaft(en) wohl vertraut. Wir dagegen müssen weitgehend bei null anfangen. Zeit wird es. Das Schmieden von Schwertern ist kein Spaziergang.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?



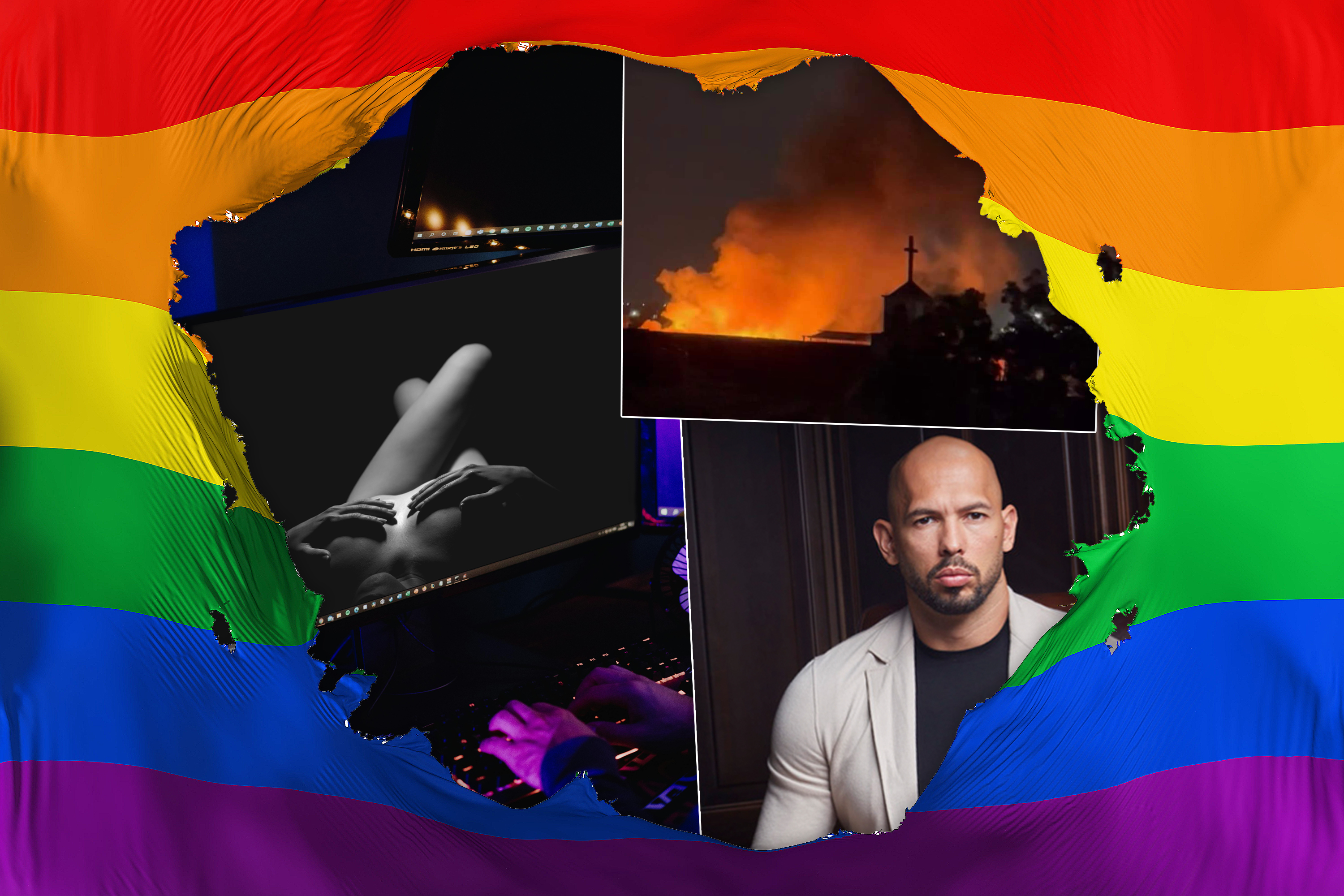

Kommentare
Den Diskussionsbeitrag möchte ich nicht unwidersprochen lassen. Der Autor stellt Forderungen auf, die falsch sind. Diese untermauert er mit dem hochmütigen Konzilstheologen Romano Guardini, der behauptete, der technische und ökonomische Fortschritt des Menschen sei nicht das Problem. Das Problem sei, dass der ethische und spirituelle Fortschritt nicht Schritt gehalten habe. Muss die Ethik und die Spiritualität Schritt halten? Nein, der Glaube muss nicht neu erfunden werden. Der Mensch muss in Demut den Willen Gottes erfüllen, der im Evangelium eindeutig erkennbar ist. Das gilt für alle Zeiten. Der Autor spricht weiter von "Wir". Wer ist "Wir"? Wie wir wissen, hat der in dem Beitrag hochgelobte Häretiker-Papst Franziskus nur für Progressive ein offenes Ohr. Die Traditionalisten sind für ihn ein rotes Tuch und immer wieder ein Gegenstand der Kritik. Nein, bei Null müssen wir nicht anfangen. Die Tradition hat immer gewusst, wie die Schwerter geschmiedet werden. Das beste Bildungsprogramm ist der Katechismus, das Gebet, das Studium der Bibel und das Hineinlesen in die Frömmigkeitsliteratur. Das geht auch im Alltag. Das hat in jeder Zeit funktioniert. Sehr wohl leben wir in einer zunehmend feindlichen Umwelt. Das ist kein Hindernis, denn Christen haben sich in jeder Zeit behauptet und werden das weiter tun. Wurde die geforderte intakte Gemeinschaft nicht durch das Aggiornamento, der Anbiederung an die Welt, gesprengt und dadurch die Vereinzelung gefördert?
Lieber Herr Graf, Sie scheinen einem Missverständnis aufzusitzen. Mit spirituellem und ethischen Fortschritt meine ich ja nicht eine Anpassung der Lehre an die Zeit, sondern im Gegenteil deren voranschreitende Verwirklichung im individuellen und gemeinschaftlichen Leben. Die 4 genannten Punkte sollten das aber auch hinreichend deutlich gemacht haben.
Das sind bedenkenswerte Gedanken, lieber Herr Vetterle. Nur scheint mir, Sie würden den Papst und insbesondere seine Enzyklika etwas zu positiv darstellen.
Lieber Stiller Leser, mir ist bewusst, dass in der Kirche in den letzten Jahrzehnten eine Hermeneutik des Misstrauens gegenüber dem Lehramt eingezogen ist. Allein ich bin nicht der Überzeugung, dass dies in irgendeiner Form förderlich für den Aufbau des Leibes Christi ist und auch nicht im Sinne unseres Herrn. Ich denke, wir Schulden dem und jedem Heiligen Vater eine wohlwollend Interpretation. So schwer es manchmal vielleicht auch fallen mag.
Wer in diese Richtung weiter denken und arbeiten möchte melde sich bitte unter [email protected].