Sankt Martin (ge)teilt

Der Kampf um das, was wahr ist, wird im Alltag selten akademisch geführt. Viele Kriterien, die wenig mit intellektuellen Einsichten zu tun haben, werden dabei ins Feld geführt. Nicht selten endet daher der Kampf wie beim Hornberger Schießen in der Ergebnislosigkeit. Das liegt daran, dass, so sehr man auch Objektives bemüht, um die Wahrheit zu ergründen, am Ende doch die Subjektivität siegt.
Es ist die sogenannte „gefühlte Wahrheit“, die für sich das Recht beansprucht, die eigentliche zu sein. Es gibt die „gefühlte Temperatur“, die von dem erheblich abweicht, was das Thermometer sagt. Es gibt das „gefühlte Köpergewicht“, das von Abnehmwilligen als anders empfunden wird, als es die Waage bekundet. Es gibt einen „gefühlten Zeitbegriff“, der sich oft von der Wirklichkeit extrem unterscheidet, zum Beispiel, wenn man in Zeitdruck hinter einem Rübentraktor herfährt, der einem die Fahrtdauer doppelt so lange erscheinen lässt, als sie es in Wirklichkeit ist.
Oder wenn man als Schüler oder Student in einer schier nicht enden wollenden Unterrichtsveranstaltung sitzt, deren Sinn sich einem auch bei intensivem Bemühen nicht erschließt und sie deswegen „gefühlt unendlich“ sein lässt.
Eine interessante gefühlte Wahrheit tritt jedes Jahr pünktlich Anfang November zutage. Sie betrifft die Textsicherheit am Sankt-Martins-Umzug. Um den 11. November, dem Fest des hl. Martin von Tours, ziehen ihm zu Ehren die Laternenumzüge als folkloristische Restbestände des Christentums durch die Städte unseres Landes.
Die Abweichung von eigentlicher und gefühlter Wahrheit
Dabei sein muss natürlich ein berittener Martin im roten Umhang des römischen Hauptmanns, ein Feuer und ein in einem kurzen Rollenspiel zur Martinsgeschichte der berühmten Mantelteilung notwendiger Bettler als Empfänger der edlen Hilfsaktion. Und es braucht Martinslieder. Die Kinder schmettern sie in der Regel laut und sicher, weil sie sie gerade erst kennengelernt und geübt haben. Die begleitenden Erwachsenen jedoch müssen feststellen, dass ihre Textsicherheit meist eher „gefühlt“ als real ist. Beispiel: das Lied „Ich geh’ mit meiner Laterne“.
Da merkt man – trotz der Tatsache, dass es ein bekannter Gassenhauer ist – am Verhältnis von Lautstärke und Textverlauf, dass da mit der Textsicherheit etwas nicht stimmt. Bringt man die beiden Faktoren nämlich in ein Diagramm, so beginnt die Laustärke auf hohem Level beim Beginn des Liedes, wo es heißt „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“.
Dann wird die Lautstärke schon ein wenig schwächer, wenn es heißt „Da oben, da leuchten die Sterne, da unten, da leuchten wir“. Schließlich sinkt sie gegen Null bei der Passage „Ein Lichtermeer zu Martins Ehr’“, um dann wieder ganz nach oben zu schnellen, wenn alle lauthals den letzten sinnfreien Teil grölen können: „Rabimmel, rabammel, rabumm – bumm, bumm!“
In dieser Konstellation wird die „eigentliche Wahrheit“ – dass nämlich das Lied keineswegs in seiner Ganzheit sehr bekannt ist – zur „gefühlten Wahrheit“, dass alle das Martinslied bestens kennen.
Diese Abweichung von „eigentlicher“ und „gefühlter“ Wahrheit trifft in noch weit größerer Härte ein anderes Martinslied, jenes nämlich, das mit „Sankt Martin, Sankt Martin“ beginnt. Hier erliegen die Erwachsenen regelmäßig ihrer Vergesslichkeit, die sie spätestens bei der zweiten Textstrophe aussteigen lässt.
Die Geschichte der hilfreichen Sozialaktion ist nur der eine Teil …
Kein Wunder, denn das Lied erzählt ja nicht nur von der Tatsache, dass da oben die Sterne leuchten und da unten wir, sondern es erzählt die Martinsgeschichte. Die Kinder sind hier im Konkurrenzkampf der Martinssänger klar die Sieger, denn sie haben das epische Martinslied in Kindergärten und Schulen gelernt. Wobei – auch sie kennen nur die halbe Wahrheit. Denn sie werden in der Regel nur mit dem ersten Teil der Geschichte konfrontiert, in dem das Lied davon berichtet, dass Sankt Martin durch Schnee und Wind reitet, dass ihn sein Mantel warm und gut deckt.
Dass da plötzlich im Schnee ein armer Mann sitzt, der nicht Kleider, sondern Lumpen anhat und in seiner großen Not um Hilfe bittet, bevor der bitt’re Frost sein Tod wird. Man erfährt, dass Martin die Zügel seines Rosses anzieht und unverweilt seinen Mantel teilt, um ihn still an den Bettler abzugeben, der jedoch keine Chance mehr hat, es ihm zu danken, weil Martin in Eil’ hinwegreitet „mit seinem Mantelteil“.
„Ich geh’ mit meiner Laterne“
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Ein Lichtermeer zu Martins Ehr’. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ein Lichtermeer zu Martins Ehr’. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Ein Kuchenduft liegt in der Luft. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ein Kuchenduft liegt in der Luft. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Beschenkt uns heut, Ihr lieben Leut. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Beschenkt uns heut, Ihr lieben Leut. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Ich trag’ mein Licht und fürcht’ mich nicht. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich trag’ mein Licht und fürcht’ mich nicht. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
Soweit der allgemein zugängliche Teil der Geschichte, den man – sicher auch aus Gründen der in einer multireligiösen Gesellschaft stets geprüften Zumutbarkeit – als alleinigen Inhalt des Martinsfestes pflegt, weil er sich am ehesten geschmeidig an die radikal unreligiösen Lichterfeste und -umzüge annähert und ihnen ein unbestimmtes humanes Gefühl der Solidarität hinzufügt, dass man eben auch ohne Religion haben kann.
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge.
Damit ist das Absingen des Martinsliedes einer womöglich unpassenden religiösen Dominanz entkleidet, die störend auf Nichtchristen wirken könnte. Es bleibt bei einem Martin als Vorreiter moderner Sozialpolitik. Die „gefühlte Wahrheit“ zum Laternenumzug ist, dass man glaubt, über Martin alles Notwendige zu wissen, was heute kommunizierbar ist.
Was aber sagt die „eigentliche Wahrheit“? Sie offenbart sich erst, wenn man das Lied entgegen allgemein üblicher Praxis einmal zu Ende liest oder singt und nicht den zweiten Teil – ähnlich dem geteilten Mantel des hl. Martin – mitsamt dem armen Bettler im Schnee zurücklässt. Denn in den regelmäßig unterschlagenen Strophen fünf bis acht kündet das Martinslied nämlich von der „eigentlichen Wahrheit“ des Mantelteilens, die sich keineswegs in der „gefühlten Wahrheit“ einer hilfreichen Sozialaktion erschöpft.
… der andere ist der Weg zu Jesus Christus
In diesen Strophen erfahren wir, welchen Sinn die Begegnung des Reitersoldaten mit dem Bettler vor den Toren von Amiens hatte. Dem Martin erscheint nämlich anschließend im Traum Christus, der seinen halben Mantel trägt. Er zeigt dem noch ungetauften Martin, dass Er es war, der ihn da um Hilfe bat, woran wir lernen, dass Christus selbst es ist, der uns in den Armen und Bedürftigen begegnet.
„Sankt Martin“, so heißt es da im Lied weiter, „sieht Ihn staunend an, der Herr zeigt ihm die Wege an. Er führt in Seine Kirch’ ihn ein und Martin will Sein Jünger sein. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin wurde Priester gar und dient Ihm fromm an dem Altar, das ziert ihn wohl bis an das Grab, zuletzt trug er den Bischofsstab.“
„Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
sein Ross, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut:
sein Mantel deckt’ ihn warm und gut.
Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hatt’ Kleider nicht, hatt’ Lumpen an.
„O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod!“
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Ross stand still beim armen Mann,
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt’
den warmen Mantel unverweilt.
Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin gab den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil’
hinweg mit seinem Mantelteil.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin legt sich müd’ zur Ruh,
da tritt im Traum der Herr dazu.
Er trägt des Mantels Stück als Kleid
sein Antlitz strahlet Lieblichkeit.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin sieht ihn staunend an,
der Herr zeigt ihm die Wege an.
Er führt in seine Kirch’ ihn ein,
und Martin will sein Jünger sein.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin wurde Priester gar
und diente fromm an dem Altar.
Das ziert’ ihn wohl bis an das Grab,
zuletzt trug er den Bischofsstab.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin, o du Gottesmann,
nun höre unser Flehen an,
O bitt’ für uns in dieser Zeit
und führe uns zur Seligkeit.
Mit anderen Worten: Christus lehrt Martin, dass seine Hilfsbereitschaft nicht nur auf der „gefühlten Wahrheit“ eines sozialen Gewissens beruhen darf, sondern auf die Einsicht folgen muss, dass Gott selbst uns in den Hilfesuchenden begegnet und deswegen die Liebe zu den Armen und Leidenden zum Gebot erhebt.
Die Nächstenliebe soll nicht bloß dort herrschen, wo Menschen aus sich heraus humane Gefühle entwickeln, sondern soll immer und überall gelten, auch dort, wo es lästig ist und schwerfällt, dort, wo es zeitraubend ist und auch dort, wo die Gefühle für den Nächsten unterentwickelt sind.
So schön sich also die „gefühlte Wahrheit“ des ersten Teiles des Martinsliedes anhört, so ergänzungsbedürftig ist diese durch den zweiten Teil, in dem wir sehen, dass eine Heilung der Welt nicht durch bloße Gefühle und soziale Maßnahmen geschehen wird.
Wenn dem so wäre, dann hätten wir schon längst nach allen humanistischen Verfassungen und Parteiprogrammen eine solche heile Welt als Ausfluss mitmenschlicher Gefühle. Es wird aber nur dann wärmer in der Welt – das ist die in unserer transzendenzvergessenen Gegenwartsgesellschaft explosiv-provokante „eigentliche Wahrheit“ des Martinsfestes –, wenn Menschen ihre Mäntel für Christus teilen, der ihnen im Nächsten begegnet.
Die Größe der Entscheidung für Gott muss dem „gefühlten Sinn“ des Lebens folgen
Denn Christus fordert Liebe, wie Er sie gibt – jenseits jedes Gefühls der Sympathie. Ohne diese notwendige Verbindung zwischen Nächsten- und Gottesliebe wird dies nicht gelingen. Liebe zu den Nächsten funktioniert nur wirklich und umfänglich dann, wenn es schwerfällt, sofern sie nicht auf dem Gefühl, sondern auf der Liebe zu Christus und zu Seinem Gebot „Liebe Deinen Nächsten!“ basiert.
Dieses Gebot hilft auch dann zum Mantelteilen, wenn einem nicht danach ist und man am liebsten vorbeireiten möchte und das Ganze den Profis in Sozialämtern und Wohlfahrtsorganisationen überlassen würde. Und eben weil das nicht so einfach ist und die soziale Ader mehr braucht als eine romantische Laternenfolklore, deren Sentimentalität allenfalls das eigene Herz umflort, die aber nicht reicht, um die kalte Welt zu erwärmen, deswegen endet der abgeschnittene Teil des Martinsliedes mit einer entscheidenden Bitte: „Sankt Martin, o du Gottesmann, nun höre unser Flehen an: O bitt’ für uns in dieser Zeit und führe uns zur Seligkeit.“
Es wird langsam Zeit, dass diejenigen, deren Religion auf dem Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten basiert, neu begreifen lernen, weshalb sich heute nach über anderthalbtausend Jahren noch Menschen an Heilige wie Sankt Martin erinnern. Es ist nicht die geschickte Inszenierung ihrer sozialen Ader.
Es ist die Größe der Entscheidung für Gott, die dem „gefühlten Sinn“ des Lebens folgen muss. Denn nur der menschgewordene Gott rettet den Menschen davor, in einer Welt zu erfrieren, die durch das Gefühl allein nicht warm werden kann. Martin hat aus Mitleid geteilt. Nachdem Er Christus entdeckt hatte, wurde aus Mitleid Liebe.
Und aus seiner Liebe seine Seligkeit. Es gehört deswegen auch zum Martinsfest, dass man sich hütet, mit dem halben Mantel auch den Heiligen zu teilen und das zu vergessen, was seine Geschichte so unsterblich macht: die Gegenwart Gottes in den Armen und Leidenden.
Es wäre deswegen an der Zeit, das Martinslied wieder ganz zu singen. Damit die Welt die volle und nicht nur die „gefühlte Wahrheit“ erfährt, weshalb es selig macht zu teilen.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?


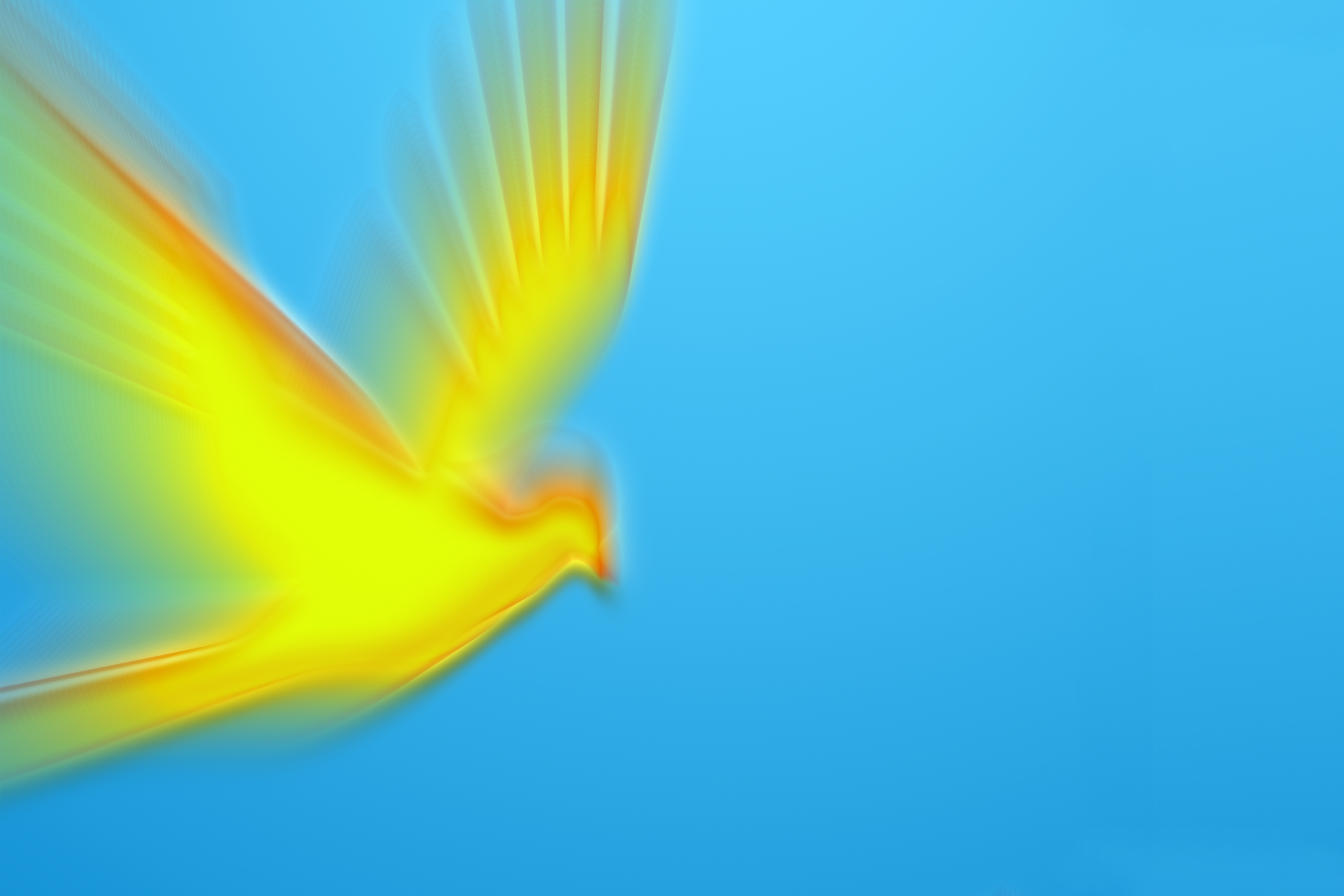


Kommentare
Mich hat der Artikel nicht überzeugt; der Kolumnist geht meines Erachtens zu hart ins Gericht mit den traditionellen Martinsfeiern.
Hätte er den Fokus zum Beispiel darauf gelegt, dass vielerorts das Martinsfest als Lichterfest bezeichnet wird und seiner Tradition beraubt wird, könnte ich dem zustimmen.
Befürworten kann ich auch durchaus, wenn der Kolumnist sich wünscht, dass das Martinslied in seiner Gänze gesungen wird, da dann der christliche Bezug verdeutlicht wird.
Dem weiteren Verlauf der Kolumne kann ich allerdings wenig zustimmen: eine Heilung der Welt durch soziale Maßnahmen halte ich durchaus für möglich, auch ohne christlichen Bezug, wenn die Maßnahmen aus dem Herzen kommen!
Mir ist ein nichtchristlicher Mantelteiler genauso lieb wie ein christlicher!
Der Hinweis , in jedem Bettler Gott zu sehen, kommt mir fast wie eine Drohung vor (... es könnte Gott sein; - und wenn du keine Nachteile möchtest, dann teile ... !! )
Ich teile, weil der Bettler kalt hat und nicht, weil der Bettler Gott oder Jesus sein könnte!!
Der Beitrag hat bei mir definitiv zur Erheiterung, durch treffliche Beschreibung der wechselnden Lautstärke beim Gesang, beigetragen.
In Bezug auf die christliche Symbolik würde ich aber doch gerne eine Kernthese des christlichen Glaubens benennen wollen, die in diesem Artikel nicht genannt ist.
Jesus Leben und Sterben beschreibt den der Menschwerdung, wie es in anderen Religionen als Weg zur Erleuchtung benannt ist. Kern dieses Zustands der Erleuchtung, bzw. des Menschseins, ist die Konstanz der sogenannten "Geteilten Aufmerksamkeit", die auch als "Gewahrsein" oder "höheres Bewusstsein" benannt und Voraussetzung für das Erkennen von und die konstante Verbindung mit Gott ist.
Das heisst, laut Bibel, wie auch vielen weiteren Schriften der Menschheit, besteht die Möglichkeit, dass mein Ich in einen anderen, unbekannten, höheren Zustand wechselt, indem ich in der Lage bin, im Erleben der Welt immer auch mich selbst wahrzunehmen. Sprich, ich kann aufkommende Emotionen und Gefühle sowie deren Reaktionsmuster (Glaubenssätze, Erlerntes Verhalten der Kindheit, soziale Muster, usw.) in mir erkennen, sie überprüfen und auf Basis von Wissen (Philosophie), Glauben und Erfahrungen eine vernünftige Entscheidung treffen.
Die Symbolik St. Martins beschreibt die geteilte Aufmerksamkeit in meinem Verständnis in zwei Aspekten. Einerseits könnte der geteilte Mantel genau diese geteilte Aufmerksamkeit symbolisieren - ich bin beim anderen und gleichzeitig bei mir. Offensichtlich erscheint mir, dass das Verhalten St. Martins symbolisiert, dass er aufgrund der Anbindung an Gott, empathisch das Leid des anderen mildern will und dies intrinisch motiviert (göttlich motiviert) als selbstverständlich erachtet, gleichzeitig aber so vernünftig handelt, dass er sich nicht selbst aufopfert, indem er alles (den ganzen Mantel) hergibt, was sein eigenes Leben vor dem Kältetod schützt.
In biblischen Gemälden stellt der Heiligenschein dann übrigens den erreichten Zustand der Erleuchtung, besser konstanten Anbindung an Gott dar. St. Martin könnte sich vor seiner Heiligsprechung also noch auf seinem eigenen Weg der Menschwerdung befunden haben und durch die symbolischen Leiden, die durch die Kälte des nunmehr halben Mantels ausgelöst wurden, in den Zustand der Erleuchtung gelangt sein.
In diesem Kontext sei erwähnt, dass Glauben hier auch den Zustand beschreibt, dass ich zwar noch keine konstante Geteilte Aufmerksamkeit und damit Anbindung an Gott erlangt habe, aber daran glaube, dass es diesen Zustand gibt.
Gläubiges Handeln bedeutet daher auch, dass ich etwas im Vertrauen darauf, dass es mich dem Göttlichen näher bringt, nachahme und tue.
Daher ist auch das gekürzte Behandeln des Liedes von St. Martin als göttliche Anbindung zu sehen und zu verstehen. Die Kinder werden motiviert caritativ zu handeln, auch wenn sie vielleicht selbst noch nicht wirklich erklären können, warum – sie sind in ihrem natürlichen Instinkt helfen zu wollen, aber meist viel näher am Glauben als "Erwachsene", die schon allerlei Muster entwickelt haben, diese natürlichen Instinkte zu unterdrücken.
Also ja, man könnte die weiteren Strophen singen. Aber auch die heutzutage genutzten sind Ausdruck des Glaubens, auch wenn es die wenigsten überhaupt verstehen können.
Vielen Dank für Ihre aufbauende Weisung. Ja, das Mitleid vom „hohen Roß“ herunter ist in der westlichen Welt nicht so selten, bei sich selbst und beim „Mitmenschen“. In dem, was geistig oder materiell armselig und bedürftig ist, im Inneren und Äußeren, Jesus Christus zu erkennen, ist eine geistliche Entscheidung, die gegebenenfalls eine große Überwindung bedeutet. Es beinhaltet implizit das Opfer, das uns Gott näher bringt. Je mehr es einen „kostet“, umso größer ist die Annäherung. Der Mann, der zum Ehemann wird, indem er in Christus seinen Trieb einschränkt für seine Ehefrau, um so wahrhaftig Verantwortung für seine Familie und Kinder zu übernehmen. Die Frau, die ihre Karriere in Christo beschneidet, indem sie mehr für ihr Kind, für ihre Familie da ist, all das ist nicht so einfach, das tut unter Umständen richtig weh. Ordensleute, die gut und gern eine Familie haben könnten, aber um Christi Willen ihr Leben fremden Menschen widmen. Sankt Martin ist ein echter Helfer in der Not, um vom angesehenen Angehörigen des Kriegsgottes Mars auf dem hohen Roß zum wahren priesterlichen und sogar bischöflichen Menschen in Jesus Christus zu werden. Heiliger Martin, bitt für uns!