Kreuzzug für den Halbmond

Die eigenen Soldaten will man in aller Regel nicht auf den Knien sehen. Jedenfalls nicht in einer Kriegssituation. Hier lag die Sache etwas anders. Es lief nur ein Wiederholungskurs, kurz WK, der Schweizer Armee, als das Bild entstand. Schüsse fielen keine, dafür Worte der Verehrung. Sie richteten sich an Allah.
Das Foto, das angeblich nicht hätte geschossen werden dürfen, zeigt Schweizer Armeeangehörige, die dem Islam angehören und in einer Übungspause gemeinsam beten. Es wurde danach medial verbreitet. Schwer zu glauben, dass wirklich ein offizielles Fotografierverbot geherrscht haben soll. Dafür wirkt das Ganze zu inszeniert. Aber das Ergebnis war ohne Frage eine Premiere: Ein gutes Dutzend Schweizer Soldaten auf den Knien gen Mekka gerichtet, während ihnen ihre Kollegen zuschauen.
Soweit die Geschichte, wie sie vor rund zwei Wochen publik wurde. Seither ist die Schweiz gespalten. Da sind die Toleranten, welche die Aktion mit Verweis auf die Religionsfreiheit verteidigen. Und auf der anderen Seite die Vertreter des christlichen Abendlandes, denen das alles zu weit geht und die darauf pochen, dass das Land nach wie vor christlich geprägt ist.
„Längst nicht mehr nur christlich“
Was auffällt, ist die Vehemenz, in der sich die katholische und die reformierte Landeskirche in die Debatte geworfen haben. Die Kirchenräte des Kantons Thurgau haben aus eigenen Stücken eine Stellungnahme publiziert, in der sie die „hasserfüllten Reaktionen“ in den Leserkommentaren bei den elektronischen Medien kritisieren. Was da bei der Armee geschah, sei problemlos, denn: „Die Schweiz ist längst nicht mehr nur christlich.“
Das ist ohne Frage korrekt. Vor 50 Jahren waren noch über 95 Prozent der in der Schweiz lebenden Menschen christlichen Glaubens. Heute sind es noch etwas über 50 Prozent. Zugenommen hat vor allem der Anteil der Leute ohne Religionszugehörigkeit, sie stellen knapp ein Drittel aller Einwohner. Der Anteil der Muslime stieg von 0,2 (1970) auf 5,7 Prozent (2021).
Man kann nun gut argumentieren, dass eine solche wachsende Minderheit auch im Schmelztiegel der Schweizer Armee abgebildet sein muss. Immerhin haben wir es mit Leuten zu tun, die im Ernstfall bereit sind, das Land zu verteidigen. Dann sollen sie in diesem Rahmen ruhig auch ihrer Religion nachgehen können, solange sie das nicht gerade daran hindert, ihre militärischen Verpflichtungen zu erfüllen.
Aber warum brauchen die Muslime in Uniform als Fürsprecher ausgerechnet die christlichen Landeskirchen? Beziehungsweise: Wo sind diese, wenn die eigene Religion unter Druck steht? Warum äußern sich katholische und reformierte Kreise dann nicht so feurig, wenn die Inhalte oder Symbole ihrer eigenen Botschaft gefährdet sind?
Weg mit dem Kreuz, her mit dem Kopftuch
Denn die wachsende Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen geht einher mit einer schleichenden Intoleranz gegenüber dem Christentum. Kruzifixe in Schulen, Gipfelkreuze in den Alpen: Man kann heute alles ungestraft in Frage stellen – und das wird auch gemacht. Auf geharnischte Reaktionen aus kirchlichen Kreisen wartet man da allerdings vergeblich.
1990 fällte das Bundesgericht, die höchste juristische Instanz der Schweiz, das Urteil, wonach Kruzifixe in Schulzimmern gegen die Neutralität der öffentlichen Schule, wie sie die Verfassung fordert, verstoßen. 2013 befand dasselbe Gericht, zwei muslimischen Mädchen sei es zu erlauben, mit Kopftuch in die Schule zu kommen. Zwar gab es ein Verbot in der Schulordnung am bewussten Ort, aber diesem fehle die „gesetzliche Grundlage“.
Sprich: Ein Kreuz an der Wand kann die religiösen Gefühle anderer verletzen, Kopftücher aber nicht. Im Fall des Kruzifixes wollte das Bundesgericht vor über 30 Jahren ganz grundsätzlich werden, im Fall des Kopftuchs verschanzte es sich hinter fehlenden Grundlagen, statt beispielsweise einfach solche zu schaffen.
Das Kreuz hat sich inzwischen faktisch sowieso erledigt. Auch wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2011 dann doch entschieden hat, dass es zulässig sei, ein solches in einem Schulzimmer aufzuhängen: Welcher Lehrer tut das heute noch? Die öffentlichen Schulen wurden generell weitgehend gesäubert von Traditionen und Werten, und keine Lehrkraft will sich dem Gegenwind stellen, den sie damit verursachen würde. In vorauseilendem Gehorsam verschwinden die Symbole des Gottes, der in der Verfassung immer noch angerufen wird.
Kreuze lösen „Traumata“ aus
Parallel dazu gab es scheinbar unpolitische Vorstöße, um dem Kreuz den Garaus zu machen. Hugo Stamm, selbsternannter Sektenspezialist und in dieser Rolle über Jahrzehnte als Experte für Schweizer Medien tätig, befand einst, der Anblick eines Kruzifixes könne „Kinder und psychisch belastete Menschen ängstigen“ und ein Trauma auslösen. Man solle die Situation an das „heutige moralische und ästhetische Empfinden“ anpassen.
Wieso Stamm weiß, wie das heutige „moralische und ästhetische Empfinden“ aussieht, ist nicht überliefert. Aber Kopftücher sind für ihn offensichtlich in Ordnung. Während der ans Kreuz geschlagene Jesus, der vor nicht so langer Zeit omnipräsent war im öffentlichen Raum und als Halsschmuck, nun offenbar die Psychiatrien des Landes füllt.
Dass die Schweizer Landeskirchen lieber Politik machen, als das Wort Gottes zu verkünden, ist nicht neu. Ihr Kampf gilt den Reichen, den Umweltverschmutzern, den Staatskritikern. Ihren Wertekompass haben sie längst verloren. Dass aber Symbole des christlichen Glaubens ohne Gegenwehr verschwinden können und sich führende Katholiken und Reformierte stattdessen lieber für betende Muslime bei der Armee in die Schlacht werfen: Das verstehe, wer will.


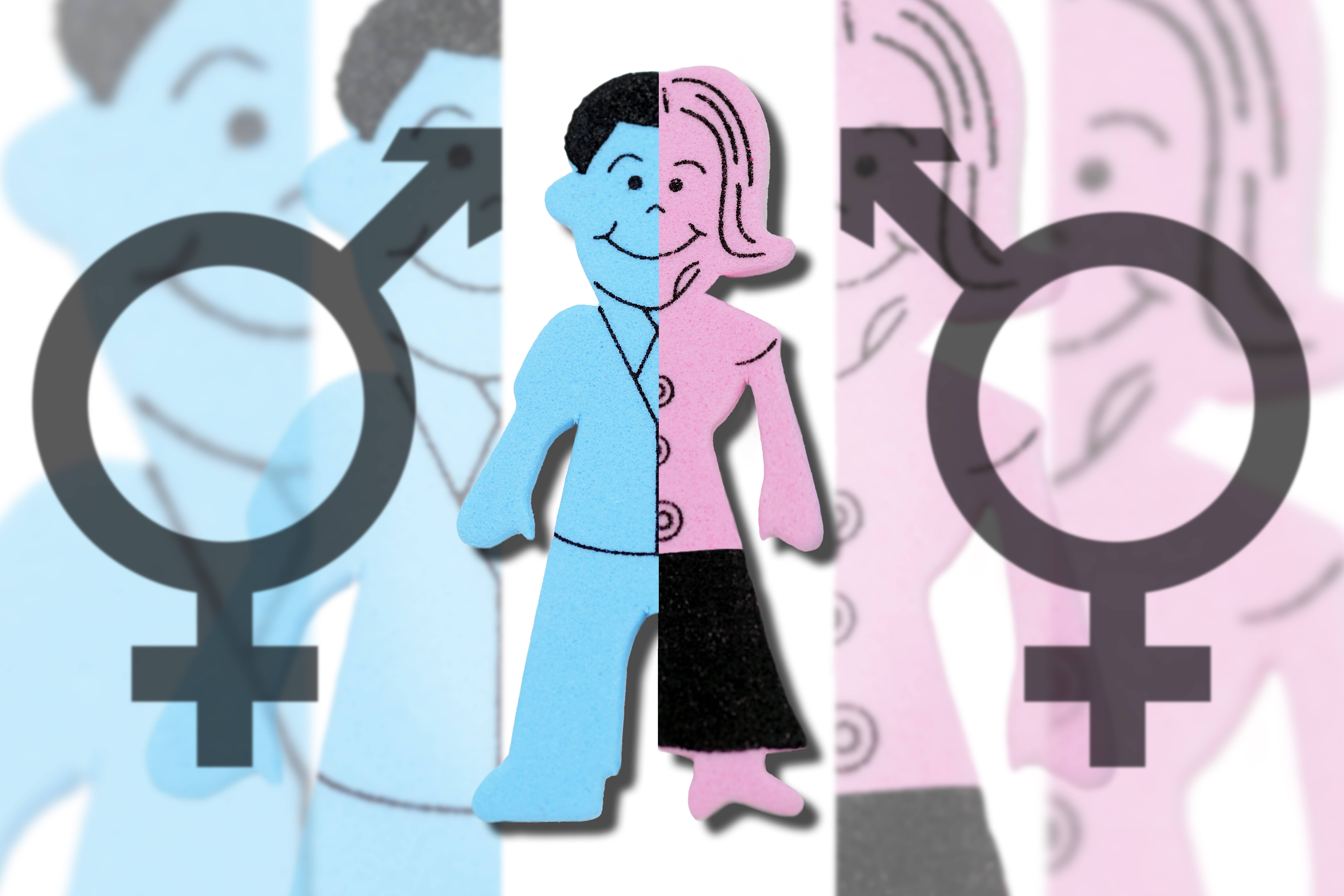


Kommentare
... vor diesem Hintergrund ist es mehr als verständlich, dass den christlichen Kirchen ihre Gläubigen davonlaufen. In was für einer kranken Zeit wir doch leben!
Christen sind selbst schuld, wenn sie in der Öffentlichkeit nicht sichtbar beten, z. B. bei Katholiken das Kreuzzeichen!, sondern sich wegducken!
Meine besten Glaubensgespräche hatte ich mit einem Muslim und einer Muslima.
Muslime bedauern oft, dass der Westen so unspirituell ist ... einen Muezzinruf möchte ich zwar nicht hören müssen, aber unsere Kirchenglocken rufen noch öfters auf als 5mal, und zwar min 24mal, jede Stunde, zum kurzen Innehalten und somit zum Stoßgebet zum Schöpfer, zum allmächtigen dreifaltigen Gott!
Lasst uns anfangen, das umzusetzen!
Warum wundern Sie sich darüber?
Wir leben in der Endzeit, und dieser große Abfall ist vorhergesagt in der Bibel.
Als bekennender Katholik habe ich viele Kontakte zu den Moscheegemeinden und Imamen, da ich sehr im christlich-islamischen Dialog involviert war. Alle Imame, die ich kennenlernte, habe ich darauf angesprochen, wie sie es finden, dass hier Kreuze aus öffentlichen Räumen entfernt werden. ALLE haben mir gesagt, dass sie das Kreuz aus theologischen Gründen zwar ablehnen, aber nicht für seine Entfernung seien; schließlich sei es ein Zeichen unserer Identität!! Daraus lerne ich, dass ich mit diesen islamischen Imamen mehr gemeinsam habe als mit den eigenen "progressiven" Kulturkämpfern.
"Zeichen unserer Identität" zu setzen schaffen Muslime bei uns ja auch mühelos, wogegen dasselbe für Christen in islamischen Staaten verhindert wird, siehe Kirchenbauten. Erinnert sei an die Ernüchterung sogar des wohlmeinenden Günter Wallraff, der den Kölner Moscheebau befürwortete, bis er für seine angedachte Lesung Morddrohungen erhielt. 24.09.2007 https://www.domradio.de/artikel/morddrohungen-ditib-lehnt-vortrag-der-s… Insofern ist es wohlfeil, wenn Muslime sich hier gegen die Entfernung von Kreuzen aussprechen.
Es wäre eher blauäugig, solches als Toleranz dem Christentum gegenüber anzusehen.
Und zu S.C-A.: Ja, „Die Analogie von Kreuz im Klassenzimmer und Kopftuch ist falsch..“ Das Auf- oder Abhängen von Kreuzen wird nämlich demokratisch diskutiert – Kopftuchtragen dagegen ist in islamischen Ländern Zwang, Frauen, die das verweigern, müssen es an Leib und Leben büßen. Deshalb verstehe ich auch die Grünlinken nicht, die es hier als weibliche Selbstverwirklichung feiern, und als "Ausdruck der Religionsfreiheit" in neutralen Orten (Schule, Gericht) durchsetzen wollen.
Als Agnostiker sind wir bei Hrn. Jung eigentlich falsch, dennoch erlauben wir uns daran zu erinnern, dass die hier angezeigte christliche Appeasement-Haltung dem Islam gegenüber nicht überrascht. Tatsächlich sind es ausgerechnet die Kirchen, die sich in x sog. Dialog-Formaten für die Anerkennung des Islam einsetzen. Bevor sie bei klarer Trennung von Kirche/Staat auf eigene religiöse Privilegien verzichten, kämpfen sie lieber für die Anerkennung des Islams als hiesige Religion mit denselben Rechten wie die christlichen Kirchen. Z.B. kostet dann zukünftig eine Stunde Religionsunterricht 4 Lehrerstunden: ev./rk/isl./plus Betreuung religionsfreier Schüler, das Neutralitätsgebot wird vollends gekippt, das Kopftuch als religiöses Zeichen zieht in Schulen und Gerichtssäle ein, wie von Rotrotgrün in Berlin bereits praktiziert, die Scharia gilt, etc. etc.
Alle anderen Religionen werden privat gelebt, jüdische Schüler werden z.B. von ihren Eltern außerhalb der Schule zum Rabbi vor Ort geschickt.
Deshalb ist ein gemeinsamer Ethik-Unterricht die einzig richtige Lösung. Glaube und Hoffnung gedeihen ohnehin eher da, wo man darum ringen muss, übersättigte Gesellschaften haben so was nicht nötig.