Waschphobie

Wenn es am zeitgenössischen westlichen Menschen eine charakteristische Handbewegung gibt, dann wohl zweifellos der sogenannte „Mausklick“. Der Mausklick als das Tippen des Zeigefingers auf eine Taste der Computermaus offenbart, was uns in der Gegenwart am meisten oder zumindest vorwiegend bestimmt. Es ist die Welt der Datenverarbeitung und der Kommunikation per Computer und vor allem per Internet.
Mehr und mehr macht sich das Netz unentbehrlich – ob beim Einkauf oder bei der Buchung einer Reise, ob als Nachschlagewerk für unbekannte Wörter oder als Mittel, per E-Mail in Kommunikation mit anderen Menschen zu treten. Durch die flächendeckende Versorgung mit Smartphones, die wie Unterwäsche den Status einer Art Grundausstattung des Menschseins erworben haben, ist man immer und überall in der Lage, mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten und sich ins internationale Netz zu begeben.
Von öffentlichen bis ganz und gar privaten Kontakten reichen die Möglichkeiten des Internets. Jeder und jedes ist erfasst. Die Straßenzüge unserer Städte und die Räume öffentlicher Gebäude sind so digitalisiert, dass man per Mausklick durch sie spazierengehen kann. Neben vielem Interessantem und Informativem, das einem offeriert wird, hält das Internet jedoch auch viele Gefahren bereit. Eine von ihnen ist die Preisgabe der Privatsphäre.
Der gläserne Mensch, der Mensch, der überall einholbar ist, ist das Nebenprodukt der modernen Technik. Und das verwunderliche ist dabei: Die meisten Menschen gewöhnen sich daran, auf dem Präsentierteller des Internets zu leben und haben kein Problem damit, wenn ihnen Google am Ende des Monats sagt, wo sie in den vergangenen vier Wochen gewesen sind oder wo sie heute vor fünf Jahren ein Bier getrunken haben.
Es gibt ein natürliches Bedürfnis, sich seiner Schuld zu entledigen
Kein Wunder, dass das Internet daher auch einen Bereich erreicht hat, der bisher für strengste Vertraulichkeit und Privatheit stand: die Beichte. Nicht wenige Foren im Internet bieten die Möglichkeit zu einer Beichte an, wobei dies natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Katholiken unter Beichte verstehen. Denn das sakramentale Bekennen und Vergeben von Sünden kann immer nur im Angesicht eines lebendigen Priesters abgelegt werden – nur für dessen Ohren bestimmt und nur durch dessen real ausgesprochene Absolution von Sünden befreit.
Nein, was im Internet als Beichte angeboten wird, ist die Möglichkeit, sich öffentlich oder nur einem bestimmten Personenkreis mit seinen Fehlern und Sünden zu öffnen und per E-Mail oder SMS ein Bekenntnis abzulegen. Zahllose Menschen nutzen mittlerweile diese Pseudobeichten, um sich das von der Seele zu reden und zu schreiben, was sie belastet. Ein interessantes Phänomen!
Denn abgesehen von der Unmöglichkeit, per Internet oder Telefon eine sakramentale Beichte ohne anwesenden leibhaftigen Priester abzulegen, eines offenbart sich anhand dieser Zeiterscheinung: Dass es ein natürliches Bedürfnis gibt, sich seiner Schuld zu entledigen, dass es für viele eine Zuflucht ist, sich über das, was sie als falsch erkannt haben, sich über eigene Fehler zu äußern und dass es für viele eine Hilfe ist, ehrlich zu sein und das herauszulassen, was im Verborgenen schlummert.
Was Psychologen nicht können
Die Psychologen leben schon lange davon, dass Menschen sich ihnen mit dem offenbaren, was sie an sich als fehlerhaft erkannt haben. Allerdings müssen die Patienten dabei immer eines vermissen: die Lossprechung von den Sünden. Der Psychologe kann nicht mehr tun als zuhören. Das hilft zwar schon. Aber das entscheidende Wort „Ich spreche dich los von deinen Sünden!“ kann er nicht sagen.
Kein Wunder also, dass die merkwürdigen Internetforen, die so etwas wie eine Aussprache über Fehler und Schwächen anbieten, den Begriff „Beichte“ verwenden, um sich interessant zu machen. Der damit verbundene Etikettenschwindel, es handle sich um eine reale Vergebung, lässt denjenigen, der die Cyberbeichte aufsucht, glauben, er werde am Ende womöglich tatsächlich absolviert.
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
An dem geschilderten Phänomen offenbaren sich gleich mehrere Bedürfnisse. Zunächst zeigt sich eine tiefe Sehnsucht des Menschen nach Reinigung von Schuld. Sodann ist es aufschlussreich zu sehen, dass es offenbar nicht genügt, mit sich selbst ins Reine kommen zu wollen. Schuld und Versagen dringen nach außen. Sie wollen aus dem Herzen über die Lippen kommen. Aber das ist nicht einfach und bedarf der Überwindung. Deswegen tun sich viele damit schwer und verdrängen ihre Schuld. Oder sie versuchen sich die Sünden schönzureden: „Kleinigkeit“, „das tun doch alle!“ usw. – was aber auf Dauer in der Tiefe des Herzens nicht funktioniert.
Der hilflose Umgang mit Schuld betrifft auch die Mehrheit der Katholiken
So hat man einen schwelenden Konflikt: Man sieht unter Umständen eine Schuld, ist aber nicht in der Lage, sie offen einzugestehen. Und so schlummert sie unter der Decke – unerlöst. Daher ist das Internet für viele heute eine Weise, im Schutz der Anonymität ihre Schuld einzugestehen. Aber – dann fehlt immer noch etwas. Denn wer ist das Gegenüber? Eine ebenso anonyme Masse? Und wer gibt die Lossprechung? Eigentlich niemand. Immer noch bleibt der Schuldbeladene allein zurück mit sich und seiner Schuld. Das unerlöste Suchen nach Vergebungsplagiaten endet auf halbem Weg und bewirkt – bis auf ein Bekenntnis vor einem Nichts – nichts.
Nun betrifft der hilflose Umgang mit der eigenen Schuld nicht nur diejenigen, die die Beichte nicht kennen, sondern interessanterweise auch eine Mehrheit der Katholiken in unserem Land, denen man das Sakrament seit Jahrzehnten katechetisch totschweigt und dessen Empfang man so gut wie unmöglich macht. Kaum unkomplizierte Beichtgelegenheiten in gewöhnlichen Pfarrkirchen, bei denen man anonym bei einem Priester eine Lossprechung bekommt.
Dafür verpsychologisierte Beichtgesprächsangebote mit Terminabsprache, die die meisten als overdressed empfinden, wenn sie den normalen und immer gleichen Alltagsschrott wegräumen wollen, ohne deswegen ein langatmiges Sofagespräch führen zu sollen, und vor allem die Relativierung des Bußsakramentes durch dessen Einreihung in andere, angeblich ebenbürtige „Angebote“ und Selbstheilungstipps moderner „Pastoral“.
Hier hat eine defizitäre Beichtseelsorge in den vergangenen Jahrzehnten ganze Arbeit geleistet. Selbst jetzt zu Beginn der Fastenzeit, in der zur Vorbereitung auf Ostern das Beichtsakrament eigentlich für jeden Katholiken auf dem Plan steht, weisen die Hirtenworte der Bischöfe nur sehr vereinzelt genau darauf hin. Das kann daran liegen, dass die Oberhirten keine Ahnung haben, wie wenig selbstverständlich die Beichte unter ihren Schäfchen ist, oder daran, dass bei ihrer Fokussierung auf gesellschaftspolitische Sündenböcke wie Klimawandelleugner oder Migrationsstopper der Blick für die Sanierung des individuellen Seelenheils ein wenig aus dem Blick geraten ist.
Ohne Beichte geht es nicht
Eine häufig gemachte Erfahrung, die ich als Priester mache, hat in der kirchenamtlichen Vergessenheit – oder sagen wir milder: der stiefmütterlichen Behandlung – des Beichtsakramentes ihren Grund. Diese Erfahrung zeigt, dass Gläubige, die doch eigentlich wissen müssten, dass es die Möglichkeit gibt, sich seiner Sünden real und objektiv zu entledigen, diese Möglichkeit nicht wirklich kennen oder sie umgehen, sie hinausschieben oder sie sogar niemals in Anspruch nehmen.
Der Grund liegt natürlich neben der Unsichtbarkeit von Beichtangeboten in dem geforderten und nicht immer einfachen inneren Anlauf, seine Sünden zu sehen und sie zu bekennen. Lieber macht man sich etwas vor und lehnt es ab, ein Sünder zu sein – wie oft hörte ich den Satz „Was tue ich denn schon, Herr Pastor?“ – oder man glaubt, es ginge auch schlichtweg ohne Beichte, und der liebe Gott würde schon im Bedarfsfall ein Auge zudrücken.
Das ist zweifellos – wenn auch nur auf den ersten Blick – die galanteste Lösung. Denn dass wir Fehler haben, dass wir Gottes Gebot oft genug nicht beachten, wenn wir neidisch sind oder hasserfüllt, wenn wir Gott in Gebet und Liturgie vergessen, wenn wir schlecht über andere sprechen oder lügen, wenn wir unfreundlich sind oder wenig hilfsbereit, wenn wir mit anderen Worten keineswegs so clean und sündenrein sind, wie wir es vielleicht gerne hätten, ist offenkundig.
Man braucht zum Test nur einmal andere über uns selbst zu befragen, denn die sehen die Fehler an uns in der Regel direkter und besser als wir selbst. Insgeheim sieht man sie ja vielleicht auch, aber ein Gewissen, das jahre- oder jahrzehntelang mit faulen Ausreden betrogen wird, meldet sich am Ende nicht mehr. Deswegen meine persönliche Empfehlung für die Fastenzeit: eine Entdeckung der Beichte für alle, die sie noch nicht kennen und eine Neuentdeckung für alle, die sie vergessen oder verdrängt haben.
Was für den Körper gilt, gilt auch für die Seele

Das, was einem im körperlichen Bereich einleuchtet, sollte man auch der Seele können: Hygiene! Niemand, der begriffen hat, dass zur Gesundheit des Körpers auch seine regelmäßige Reinigung gehört, würde das Duschen unterlassen, nur weil es einen so unangenehm nass macht. Und niemand, der morgens in die Dusche steigt, würde nach dem Betreten der Kabine das Wasser noch vor der Berührung mit ihm wieder abstellen, wenn ihm bewusst wird, dass er anschließend ja doch wieder schwitzen wird. Die nassen Güsse des Wassers sind notwendig, auch wenn sie vielleicht manchmal unangenehm sind – besonders die kalten, die nicht nur reinigen, sondern auch beleben. Und das Duschen als solches wird nicht dadurch obsolet, dass man den Körper wieder und wieder unter das Wasser stellen muss.
Es ist umgekehrt: Die Anfälligkeit für Verschmutzungen macht eine Regelmäßigkeit der Reinigung notwendig. Und was dem Körper recht ist, sollte der Seele billig sein.
Und was meine Empfehlung betrifft: Nicht zufällig nennt man die Fastenzeit vor der österlichen Festzeit die „österliche Bußzeit“. Denn sie dient dem Blick auf das, was im Menschen falsch ist, was an ihm an Bösem und Falschem haftet und was man nach dessen Erkenntnis einer Reinigung unterziehen muss, wenn man sich und anderen gegenüber ein ehrlicher Mensch sein will.
Die einzig wirksame Reinigung besteht aber in der realen Dusche der Beichte. Sie wird weder per Mausklick bewerkstelligt noch in einer anderen Form von digitaler Seelenmassage. So real wie das, was bei einem schiefläuft, so real muss auch die Beseitigung und Korrektur des Ganzen sein. Und wenn man sein Leben in Verantwortung vor Gott leben will, dann muss man auch die Spielregeln akzeptieren, die Er für den Umgang mit Gut und Böse gegeben hat. Und die sind nach der Offenbarung des Neuen Testamentes an die Bevollmächtigung des apostolischen Amtes gebunden. Hier fließen die realen Wasser der Reinigung. „Gnade“ nennt man das. Ein unverdientes Geschenk.
Man ist von daher seelisch höchst ungesund, sollte man bei sich einen grundsätzlichen Vorbehalt gegenüber der Beichte feststellen. So ungesund, wie es eine Waschphobie wäre, die die Hygiene verhindert, die der für Verschmutzungen anfällige Körper nun einmal braucht.
Die Seele von dem befreien, was sie verklebt und unrein macht
Mein dringender Rat für alle katholischen Leser, die es mit ihrem Katholischsein einigermaßen ernst meinen, lautet deswegen: Nutzen Sie die aktuelle Fastenzeit einmal weniger zum Abspecken als zur Seelenhygiene und setzen Sie sich den Realitäten Ihrer Seele aus, um sie von dem zu befreien, was sie verklebt und unrein macht – auch wenn es unter Umständen unangenehm ist.
Damit es Ihnen nicht so geht wie dem Mann, der im Winter eine Bahnreise unternimmt und auf ihr von Station zu Station erkennbar unruhiger wird, aufsteht, auf den Bahnhöfen aus dem Fenster schaut und sich nervös wieder hinsetzt.
Solange, bis ein Mitreisender ihn fragt, was los sei und ob er ihm helfen könne. Woraufhin sich herausstellt, dass er im falschen Zug sitzt und nicht zu seinem Ziel, sondern in die entgegengesetzte Richtung fährt. Wieso er dann nicht bei der nächsten Station aussteige, wird er gefragt. „Ja, ich weiß“, antwortet der Mann. „Aber es ist hier im Zug so schön warm ...“



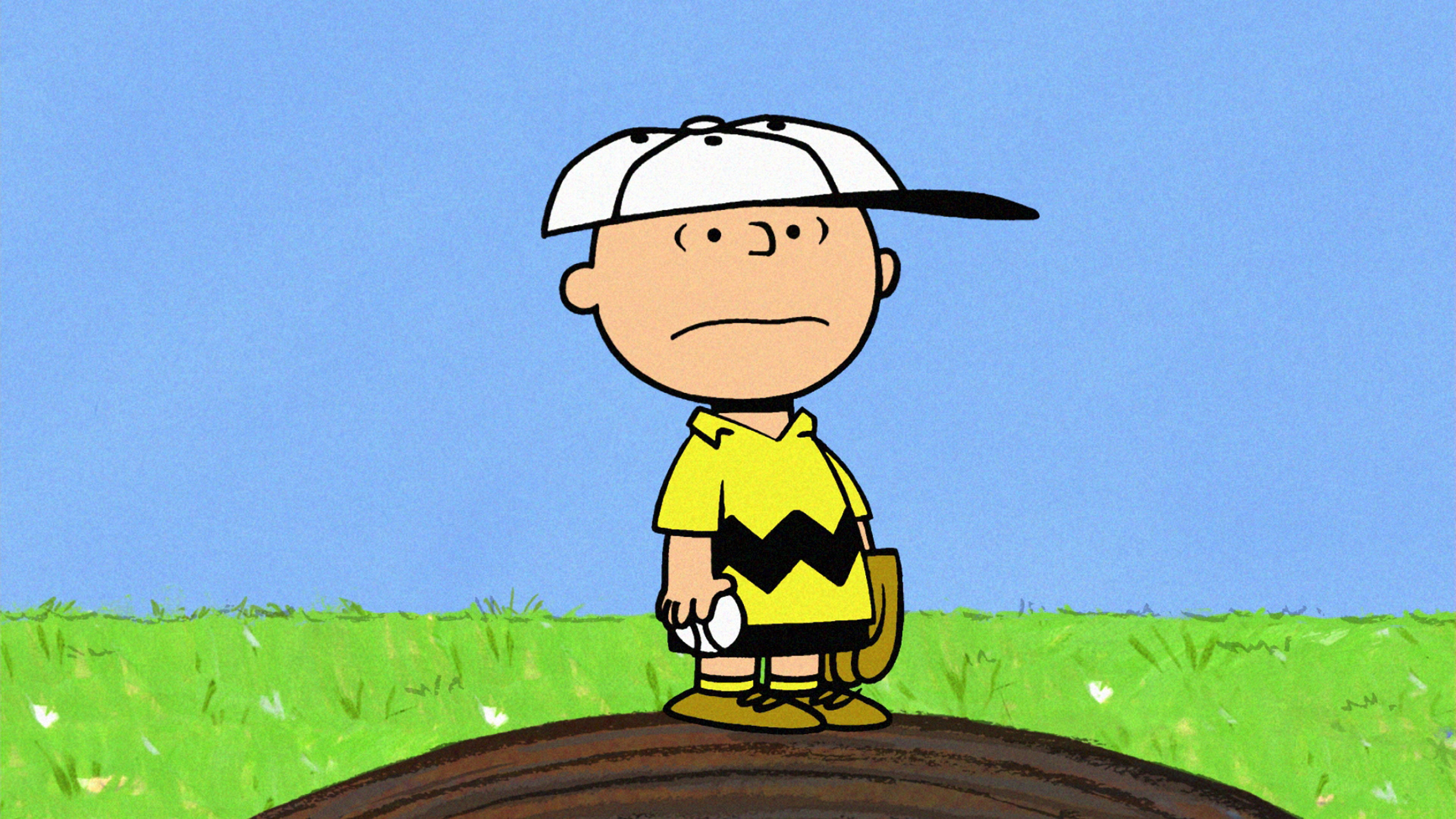

Kommentare
Deutschland braucht nicht mehr offene Beichtstühle, sondern mehr Kanzeln, von denen reines Evangelium gepredigt wird - nämlich dass der Mensch ein verdammter Sünder ist, durch Christus aber der Weg zum Vater frei ist und Vergebung jedem aus Gnade gewährt wird, der demütig Buße tut und bei seinem Herrn um Vergebung bittet.
@Stefan Eine kranke Sicht vom Menschen als „verdammter Sünder“. Ohne die geringste Übereinstimmung mit Jesu Menschenbild. Ein anderes Wort als „krank“ fällt mir nicht ein.
Wann werden die Kolumnen von Guido Rodheudt als Buch veröffentlicht? Verdient hätten sie es.
Schulden gestrichen, bezahlt hat schon ein anderer! 😢
In Trump'scher Diktion könnte man sagen: Ein echt guter "Deal" ... ;-)
(P.S.: Wer den Vergleich geschmacklos findet --> Lukas 16,8!)
Wie sollen Sünder Sündern ihre Sünden vergeben?
"IHR ABER SEID EIN AUSERWÄHLTES GESCHLECHT, EIN KÖNIGLICHES PRIESTERTUM, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden DESSEN verkündet, DER euch aus der Finsternis berufen hat zu SEINEM wunderbaren Licht."
1. Petrus 2, 9
Der Apostel Petrus sagt, dass es nicht DEN geweihten Priester gibt, weil alle Gläubigen als Priester angesehen werden.
Die persönliche Sündenvergebung mittels eines Priesters in der Beichte steht in der Bibel:
"Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten." (Johannes 20,22-23)
Jesus sagte dies zu seinen Aposteln, folglich gilt das auch für deren Nachfolger, die Priester. Das geht also nicht durch einen allgemeinen Bußgottesdienst. Allerdings ist es Jesus Christus selbst, der losspricht, er bedient sich nur des Priesters als seines Amtswalters. Die Schwierigkeit bei den meisten besteht aber darin: Wie kann ich bei einem ebenso sündigen Priester beichten, was gehen den eigentlich meine Sünden an? Hier muss man sich klar machen, dass man ja Gott seine Sünden beichtet und nicht dem Priester, der Gott nur die Stimme und Amtshandlung leiht. Ja, er ist selber auch sündig, muss also auch regelmäßig beichten, ist aber strikt an das Beichtgeheimnis gebunden und darf unter schwerer Sünde davon nie und niemandem etwas weitererzählen. Ich finde, die Hürde des Beichtens vor einem weiteren Sünder kann man überwinden, wenn man daran denkt, dass derjenige ja selber auch seine Sünden beichten sollte... Ich wünsche allen, im Priester einen guten und vertrauensvollen Beichtvater zu finden!